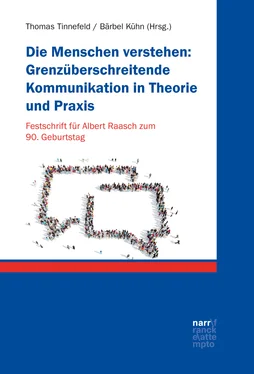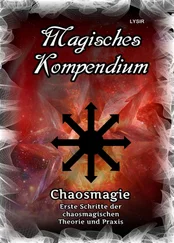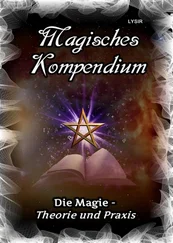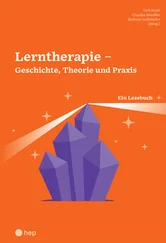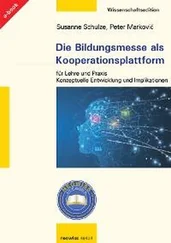Die Situation der Mehrsprachigkeit wird das Land mit einem besonderen Esprit erfüllen, der auch neue kosmopolitische Zielgruppen anlockt. Diese reizt die grenzüberschreitende „europäische“ Kulturmetropole, die auf eine Fülle an grenzüberschreitenden Kulturschaffenden und -stätten zurückgreifen kann und anders als in anderen europäischen Metropolen von kurzen Wegen profitiert. (Saarland 2020: 12)
Zum Maßnahmepaket gehörte auch der Ausbau des Netzes der bilingualen Kindertagesstätten besonders im Elsass und Lothringen, die in der Absichtserklärung einer deutsch-französische Qualitätscharta für bilinguale Kindertagesstätten unterschrieben wurde. Im Umsetzungsvertrag des sogenannten GuteKita-Gesetzes des Bundes wird auf ein Netz von mehr als 200 bilingualen Kitas des Saarlandes verwiesen, die ganzheitlich-alltagsintegriert und immersiv deutsch-französisch arbeiten (Gute-Kita-Gesetz o.J.: 11) und in denen schon Dreijährige mit beiden Sprachen aufwachsen. Das sind insgesamt etwa 40 % der Kitas des Saarlandes (zur entsprechenden Entwicklung in Sachsen vgl. Gellrich 2015). Zur sprachenpolitischen Erfolgsgeschichte gehören auch zahlreiche Initiativen in Bezug auf die zweisprachige Berufsausbildung, insbesondere in der Automobilindustrie mit ihren großen Produktionsstandorten (Smart in Lothringen, Ford in Saarlouis, Saarland). Parallel zum Kita-Projekt wurde im Jahre 2013 auch die Fachstelle für grenzüberschreitende Ausbildung in Dillingen gegründet mit einem Angebot an lothringische Lycée -Schülerinnen und -Schüler bzw. Studentinnen und Studenten (Niveau Bac Pro und BTS). Sie können im Projekt Teile der Pflicht-Praxisphasen in einem saarländischen Betrieb absolvieren. Saarländische Auszubildende und Fachoberschüler können einen Teil ihrer Berufsausbildung bzw. ein Praktikum in einem französischen Betrieb absolvieren. Eine Pressemitteilung auf der Internetseite des Saarlandes meldete 2017 gestiegenes Interesse an diesem Angebot (Saarland – Themenportale 2017), was ich aus meinen persönlichen Erfahrungen in Lothringen bestätigen kann.
Zwar wurde das strategische Projekt auch von der Nachfolgeregierung fortgeführt (Saarland 2020), und die Erfolge sind sichtbar, aber der Weg zu den visionären Zielen erscheint lang und man ist unwillkürlich an die beiden ersten Murphy-Gesetze erinnert: Alles dauert länger als man denkt, und nichts ist so leicht, wie es aussieht.
Man kann vermuten, dass die Zeit der Grenzschließung von März bis Mitte Juni 2020 zwar vielen Menschen die Zusammengehörigkeit der Region bewusster werden ließ, wie viele aktuelle Nachrichten aus den Grenzgemeinden zeigen, und Fortschritte in Richtung regionaler Kooperation nicht unumkehrbar sind, aber die Prioritäten auch staatlichen Handelns waren hier eher ökonomisch und nicht kulturpolitisch bestimmt. Auf der Regionalkonferenz der Region im Jahre 2019 scheint die Sprachenfrage keine Rolle gespielt zu haben. Im Mittelpunkt standen die berufliche Mobilität und die allgemeine Wirtschaftsentwicklung.
3 Sprach- und Bildungspolitik im deutsch-polnischen Grenzraum – eine Langzeitstudie
Infrastrukturell wesentlich weniger differenziert ausgebaut ist die Situation in den Grenzregionen zu Polen und der Tschechischen Republik. Wegen der unterschiedlichen Wirtschaftsdynamik und der vergleichsweise asymmetrischen Mobilität auf dem Arbeitsmarkt erscheint ein direkter Vergleich der Regionen wenig sinnvoll. Eine aktuelle Langzeitstudie gibt allerdings Einblicke in schulische Entwicklungen, die die Entwicklungen von Sprachbedürfnissen und Einstellungen zur Mehrsprachigkeit genauer beschreiben. Die Dissertationsschrift mit dem ursprünglichen Titel Europäische Mehrsprachigkeit, bilinguales Lernen und Deutsch als Fremdsprache: Längsschnittstudien zum Nachbarsprachenlernen im ostsächsischen Grenzraum, vorgelegt von Dorothea Spaniel-Weise (2018), wurde inspiriert u.a. durch die Arbeiten von Albert Raasch, auf den sie sich auch an verschiedenen Punkten direkt bezieht.
Spaniel-Weise (2018) fasst Modelle des mehrsprachigen fachlichen Lernens ( Content and Language Integrated Learning , CLIL) ebenso zusammen wie den Zusammenhang zwischen Wirtschaftserfolg und Mehrsprachigkeit – wie ihn die große ELAN-Studie der EU (ELAN 2006) im Jahre 2006 belegt hatte –, wie die Ebene der theoretischen Positionen zur europäischen Identität, die in Habermas’ Forderung nach einer europäischen Diskurskultur (Habermas 2014: 111) und Foucaults Postulat des Nationalen als unverzichtbarem Ordnungsschema zum Ausdruck kommen. Dass Grenzkompetenz sich aus einer Fülle unterschiedlicher Faktoren wie Mobilität, Bildung und Mehrsprachigkeit zusammensetzt, die nicht automatisch im Zuge umfangreicher Maßnahmen top-down entstehen, zeigt die Verfasserin an vielen Beispielen. In ihrer historischen Betrachtung wird deutlich, dass bereits die deutsch-tschechisch-polnischen Grenzen in der Geschichte der DDR je nach politischer Lage im Nachbarland jeweils offener oder geschlossener waren, dass das Erlernen der Sprache des Nachbarn auf deutscher Seite nie besonders ausgeprägt war und dass die Aktivitäten etwa des deutsch-polnischen Jugendwerkes im Vergleich zum deutsch-französischen eher weniger umfangreich sind, bzw. auf zahlenmäßig geringeres Interesse in Deutschland stoßen. In dieser Asymmetrie liegt sicher das Grundproblem mangelnder Nachhaltigkeit von Einzelmaßnahmen begründet.
Waren mit Konzepten wie bilinguales Sach-Fach-Lernen (CLIL & CLILIG) einst Hoffnungen auf ein europäisches Schulmodell verbunden, so zeigt die zurückgehende Zahl der Neueinrichtungen trotz aller ministeriellen Förderung und durch die KMK, dass sich diese Hoffnungen nicht erfüllt haben. Die Skepsis vieler Fachdidaktiker und Spracherwerbsforscher (Long 2019) mag dazu beigetragen haben, letztlich fehlten aber auch die infrastrukturellen bildungspolitischen Voraussetzungen, vor allem in der Ausbildung von Fachlehrkräften mit entsprechender Fach-Qualifikation und fremdsprachlicher Kompetenz und in der Bereitstellung adäquater Lernmaterialien, die vom Markt so nicht hervorgebracht werden und staatlicher Förderung bedurft hätten; und schließlich fehlte auch systematische Weiterbildung in Bezug auf zweisprachiges Team-Teaching .
Kern der Studie von Spaniel-Weise sind Datenerhebungen in den bilingualen Schulen in Görlitz und Pirna. Die Datenerhebung, die in der Vorstudie der Jahre 2002-2004 aus einer Lerner-Befragung bestand und in der späteren Hauptstudie aus einer Expertenbefragung, die die Verfasserin in ihrer Methodik an Zydatiß anlehnt (Spaniel-Weise 2019: 178), sind umfangreich und dienen dem Ziel, die Forschungsfragen näher zu beleuchten. Tatsächlich gehen sie in ihren Details und im Umfang über dieses Ziel hinaus und erheben Daten, die einen Einblick in verschiedene Ebenen des schulischen Handelns, aber auch in die Motive, Haltungen und Einstellungen von Schülerinnen und Schülern in den Institutionen geben, jedoch auch in die Wirksamkeit und die Intentionen von Maßnahmen der sächsischen Kultusverwaltung. Wertvolle Aufschlüsse im Sinne einer konzeptuellen Ausrichtung liefern ebenfalls die Daten zu den Ergebnissen der Sprachausbildung, sowohl in Bezug auf die erreichte Kompetenz als auch auf die Einstellungen der Schülerinnen und Schüler zu den jeweiligen Nachbarsprachen – und nicht zuletzt auf die strukturellen Defizite der angebotenen sprachlichen Bildung. Diese liegen vor allem in einer unzureichenden Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte für den Umgang mit mehrsprachigen Settings. Obwohl die Schülerinnen und Schüler sowohl ihren Unterricht als auch die interkulturelle Lernsituation in Grenznähe generell positiv einschätzen, bleiben doch Selbstzweifel an der erreichten Kompetenz, die auch durch die zitierten Sprachstands-Einschätzungen bestätigt werden. Kompetenzfortschritte wurden weniger durch den fremdsprachlichen Sach-Fachunterricht erreicht als durch Begegnungssituationen und geplante und informelle Sprachkontakte. Hier sind die dokumentierten Kontaktsituationen jeweils aufschlussreich. An dieser Stelle schließt sich der Kreis zu dem von Albert Raasch dokumentierten, umfangreichen Strauß an beispielhaften kontaktfördernden und -etablierenden Einzelmaßnahmen in der Region SaarLorLux um die Jahrtausendwende. Auch bei der untersuchten Zielgruppe ist mit der Zeit die Einschätzung der Bedeutung des Englischen als Voraussetzung beruflicher Kommunikation deutlich gestiegen. Diese Entwicklung wird auch auf tschechischer Seite durch bildungspolitische Maßnahmen, die trotz der geographischen Nachbarschaft zu zwei deutschsprachigen Ländern eindeutig das Englische durchgängig präferierten, gestärkt.
Читать дальше