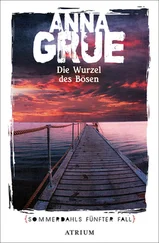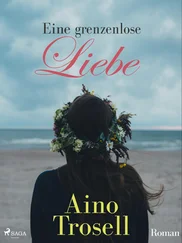Aino Trosell
Die Taucherin
Roman
Aus dem Schwedischen
von Gisela Kosubek
Saga
Diese Geschichte handelt von Angst. Angst vor dem Wasser. Angst vor dem Unbekannten. Angst vor der Tiefe und davor, daß es immer dunkler wird, je tiefer man kommt. Daß der Druck steigt und die Lebenschancen sinken, wenn man den Griff lockert und es einfach geschehen läßt. Wenn man sich preisgibt.
Und ich träume – ich träume, eins zu sein mit meinem Element. Es ist dunkel, und ich treibe vorwärts durch das Unbekannte, kann nicht stoppen. Habe keine Kontrolle.
Plötzlich strahlt ein Scheinwerfer auf, und ich sehe den Meeresboden, ich bewege mich über den Schlick dahin, während der Ton meinen Körper mit seiner Riesenfaust knetet. Wie in einem Schraubstock stecke ich hoffnungslos fest. In meinem Traum. Der Griff dieser Faust – ich kann ihm nicht entkommen.
Eine Pipeline taucht im trüben Wasser auf. Es ist tief, woher weiß ich das? Es muß der Ton sein und das so ganz andere Element. Und weil es dunkel ist. Ich bin gezwungen, Licht mit nach unten zu nehmen.
Der Ton preßt das Wissen in meinen Körper, immer tiefer hinein in meinen Körper.
Und die Pipeline mündet in ein Bohrloch, von dem Rohre über den kargen lehmigen Boden wegführen, andere Rohre tauchen auf und verschwinden allesamt in Dunkelheit, in Finsternis. Stahlschlangen, unbiegsam und unbeweglich, ringeln sich über den welligen Boden, über einzelne Stahlbrücken, über Risse und Spalten, so als gäbe es die Härte des Stahls nicht.
Ein riesiges Fundament?! Beton. Wer bin ich? Wohin geht es? Der Lichtkegel sucht sich aufwärts, immer weiter aufwärts. Wie lange? Wie weit noch? Der Druck verändert sich, ich fühle es an dem Griff der Riesenfaust.
Licht? Ja, Licht, von oben jetzt. Ein graues Dämmerlicht, in dem Fische ruhig vorbeischwimmen.
Eine gewaltige Ankerkette. Der Griff der Tonfaust verändert sich. Ein Dach über mir? Was hindert das Licht? Kein Dach ... die Unterseite eines Schiffes!
Die Schrauben bewegen sich gemächlich, drehen sich gegeneinander, um das Schiff an Ort und Stelle zu halten.
Die Tonfaust löst erleichternd ihren Griff, und ich stoße an die Oberfläche.
Wirklichkeit! Richtige Töne, das Klatschen der Wellen und Möwengeschrei.
Ich liege auf dem sprühenden Wasser. Ich sehe die Schiffswand, die Spanten drücken gegen die Außenhaut. Biegen sich wie Rippen, ich sehe es aus meiner Fischperspektive, und nicht weit entfernt die große Bohrinsel auf ihren Betonfundamenten, die, ich weiß es jetzt, tief, unsagbar tief unter den Meeresspiegel reichen, bis dorthin, wo nur Druck, Dunkelheit und Angst existieren. Meine Antiweit.
Und die Sonne strahlt, die Möwen schreien, und der Himmel ist blau. Ich lebe – Gott, ich danke dir.
Unter mir lauert das Unbekannte.
Diese Geschichte handelt von Angst. Meiner Angst. Von mir. Ich kann mit diesem Wortungeheuer spielen, ohne seinen giftigen Biß zu spüren; ich erzähle, und ich habe Angst. Doch in der Welt, die ich schildere, wird dieses Wort nicht benutzt. Niemals!
Angst ist ein Nichts unter der Oberfläche.
Angst ist wasserlöslich, wird aufgelöst.
Angst verbindet sich mit dem Element selbst. Wird ein Teil von ihm.
Hat keinen eigenen Namen.
Keinen Namen.
Ein Schweißtropfen läuft langsam über die Stirn, dann die Nase hinunter. Er wischt ihn irritiert weg.
Er steht über die geräumige Nylontasche gebeugt und füllt sie mit Slips, Unterhemden, Taschenbüchern, Kassetten, Strümpfen, T-Shirts, Pullovern und Werkzeug. Er ist fünfunddreißig Jahre alt, blond, durchtrainiert und braungebrannt. Wenn sein Blick nicht so unzufrieden wäre, würde er richtig gut aussehen.
Eigentlich hat er keine Eile, aber er hetzt, als warte das Flugzeug nur noch auf ihn.
Es ist still. Hinter ihm steht seine Frau in der Türöffnung, hat ihm den Rücken zugewandt. Sie ist im siebenten Monat schwanger, über dem Hohlkreuz hängt das Kleid locker herunter. Doch vorn wölbt sich ihr Bauch schon deutlich.
Er schielt hastig zu ihr hin, als er die Kommodenschublade noch einmal aufreißt, um weitere Strümpfe einzupacken. Man weiß ja nie.
Nein, man weiß nie.
Der fünfjährige Sohn kommt ins Zimmer. Er preßt sich an Mutters Beine, während er Ian ansieht, der darauf das Packen unterbricht.
Seine Hände sinken herab. Müdigkeit überfällt ihn. Ach könnte man sich doch unter eine schützende Bleidecke legen, um geröntgt, operiert und von all diesen lästigen Forderungen befreit zu werden! Für krank erklärt werden, todkrank, wenn nötig!
Der Sohn sieht ihn an. Vom Rücken seiner Frau gehen Signale aus.
Er sagt, er tue es doch für sie beide, weil er sich um ihr Wohlergehen sorge.
Verächtliches Schweigen. Ginge es nach ihnen, würde er nicht fahren, so einfach ist es. Sie hat ihn schon so oft gebeten – fahr nicht! Fahr nicht!!
Er wiegt die Tasche in der Hand. Sie ist wirklich schwer.
Er sagt, er werde rechtzeitig zurück sein, ehe es soweit ist, doch jetzt müsse er los. In diesen Zeiten könne man über jeden Job froh sein, der einem angeboten wird.
Sie fängt an zu schluchzen, und der Junge rennt aus dem Zimmer. Ian hört, wie sich das Trommeln der kleinen Füße immer weiter entfernt.
Jetzt hält sie den Rücken nicht mehr durchgedrückt, ist in sich zusammengefallen und bebt. »Du hast doch eine Arbeit. An Land«, flüstert sie.
»Wenn es wenigstens eine andere Frau wäre«, sagt sie leise. »Ich bin bald zurück«, erwidert er.
»Und ich werde dann hier auf dich warten? Werde ich das? Sag, werde ich das wirklich?«
Er schafft es nicht, will nicht antworten, denn jetzt hupt ein Taxi auf der Straße vor dem Haus. Seine Muskeln zucken, und er schaut hinaus.
Strahlender Sonnenschein, es wird ein herrlicher Sommertag werden. Er ist schon unterwegs; sitzt in Gedanken bereits auf dem Airport in Aberdeen, um das nächste Flugzeug nach Stavanger zu nehmen.
»Leih dir ein Video aus«, sagt er. »Oder geh ins Restaurant, dir fällt schon was ein, wir haben genug Geld, mach dir keine Sorgen, ich bin bald zurück – dann machen wir dort weiter, wo wir jetzt aufhören.«
In roten Versalien stürzt Deep seahorse über das runde blaue Feld mit schwarzem Rand, das Logo, ein großer Aufkleber, schmückt eine Tasche, Handgepäck, das ein etwa fünfzigjähriger Mann über der Schulter trägt. Sein faltiges Gesicht zeugt von teuer erkaufter Lebenserfahrung. Die Augen sind ausdrucksvoll, blikken wehmütig. Sein Haar ist grau, und der Haaransatz hat sich nach hinten verschoben, dennoch wirkt die noch immer schlaksige Gestalt irgendwie jungenhaft. Er bewegt sich geschmeidig, ja schön.
Er geht über das Vorfeld des Flugplatzes von Stavanger. Sonnenreflexe funkeln in den großen Fenstern der Ankunftshalle. Seine Kleidung ist abgewetzt, dieselbe Bundjacke Sommer wie Winter, als sei er ein Habenichts. Doch ist seine Armut von anderer Art.
Die Maschine, in der er gesessen hat, ist jetzt leer, auch das Gepäck ist ausgeladen. Vor einem Flugsteig warten schon eine Reihe Geschäftsleute, die mit demselben Flieger zurück nach Göteborg wollen. Glenn bemerkt sie nicht. Geistesabwesend tritt er in den kühlen Schatten der Ankunftshalle, wo ein Tumult sofort seine Aufmerksamkeit auf sich zieht.
Anfangs sieht er nicht, woher das Geräusch kommt, hört nur laute Stimmen, hin und wieder Geschrei und entrüstetes Gemurmel.
Es rührt von einem Gepäckband her. Eine Gruppe von Passagieren, vielleicht zurückkehrende Mallorca-Touristen, wartet an dem Band, und irgend etwas passiert dort. Frauen und Männer in leichter Sommerkleidung, auf dem Kopf Panamahüte, gestikulieren und schimpfen – worüber?
Ein junger Mann in teuren Cowboyboots fläzt sich auf einen Stuhl und lacht. Er hat die Beine ausgestreckt, den Hut in den Nacken geschoben, und er lacht schallend, eine Dose Elefantenbier in der Hand. Auf dem Boden steht seine Tasche – mit dem Firmenzeichen von Deep Seahorse in leuchtendem Rot, Blau und Schwarz.
Читать дальше