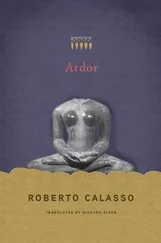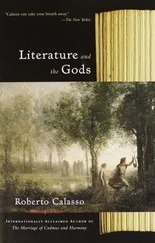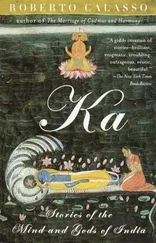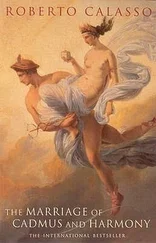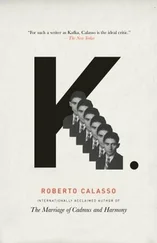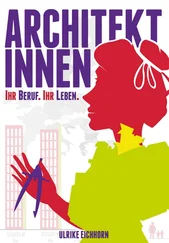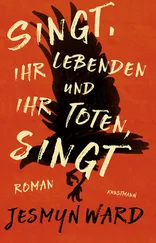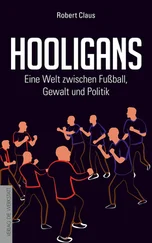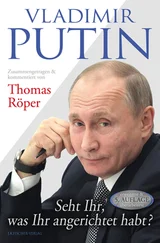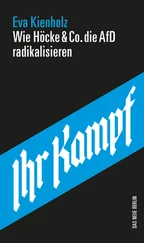Parallel zu dieser Entwicklung bleibt MMA sportpolitisch und -ethisch in Deutschland stark umstritten. Der DOSB positionierte sich 2009 gegen MMA und bezeichnete es als „Pervertierung der Werte des Sports“. Es ging um die Frage, ob es sportethisch vertretbar ist, dass Kämpfe nicht automatisch abgebrochen werden, wenn ein Kämpfer am Boden liegt oder blutet. Diese Kritik kam auch zum Ausdruck in der Empfehlung der bayerischen Landesmedienanstalt, MMA-Kämpfe nicht im Free-TV zu senden. Dem Wachstum des MMA in Deutschland tat all das keinen Abbruch, zumal der Ausschluss aus dem Free-TV im Zeitraum 2010 bis 2014 mittels Internetmedien leicht zu umgehen war.
So bieten Gyms in Deutschland MMA zunehmend im Windschatten dieser Entwicklung um die UFC an. Es sind mittlerweile mehrere Hundert – wenngleich bei Weitem nicht alle auf Wettkampfniveau. Viele dieser Gyms kommen aus einzelnen Teildisziplinen, z. B. dem Jiu-Jitsu, Boxen, Muay Thai oder Ringen und vermischen ihre Kursangebote zu MMA. Da der Begriff rechtlich nicht geschützt ist, bleibt das legitim. Dementsprechend sind viele Gyms auch Mitglied in den diversen Verbänden und nehmen an verschiedenen Meisterschaften teil. Auf Sherdog.comwerden Statistiken der Wettbewerbe veröffentlicht und auf gnp1.de gibt es News aus der Szene. Übersichtlicher wird es dadurch kaum.
Doch muss angemerkt werden, dass sich der Amateursport teils weniger martialisch inszeniert, als es die kommerziellen Fight Nights tun. So sind viele Gyms vor allem durch den Stadtteil oder die Region geprägt, in denen sie liegen. Menschen mit familiärer Migrationsgeschichte trainieren ebenso wie Frauen. In Gesprächen wird oftmals betont, dass MMA als Mischung der Teildisziplinen letztlich die komplexeste und somit interessanteste Kampfsportart sei. Zudem entstehen auch erste Ansätze von MMA mit Menschen mit Behinderungen. Angebote, wie es sie im Judo, Taekwondo, Karate und Boxen bereits länger gibt. Der großen Mehrheit der Sporttreibenden geht es um Fitness, den eigenen Selbstwert und darum, sich verteidigen zu können. Es würde das Ausmaß dieses Textes sprengen, die Landschaft der Kampfsportarten in Deutschland in jedem Detail zu beschreiben. Doch lässt sich eines bereits hier festhalten: Sie ist äußerst heterogen.
Zumal auch zwischen Kampfsport und Kampfkunst unterschieden wird: Während Kampfsport den Wettbewerb beschreibt, in dem sich Kämpfer miteinander messen, geht es in der Kampfkunst eher um das Einüben von Techniken. Dies geschieht oft in tradierten Bewegungsabläufen, die technisch sauber ausgeführt werden. Darüber hinaus wird Kampfkunst oft mit einem philosophischen Überbau und ethisch moralischen Anforderungen versehen. So steht der Begriff des Budō für die japanischen Kampfkünste – von Karate über Aikido bis Judo – und wird mit Selbstverwirklichung und Selbstkontrolle im Sinne eines menschlichen Reifungsprozesses verbunden.
Weiterhin wird auch der Bereich der Selbstverteidigung von Kampfsport abgegrenzt, zählt aber dennoch zum weiten Feld des Kämpfens. Er umfasst das israelische Krav Maga, das russisch geprägte Systema sowie den chinesischen Kung-Fu-Stil Wing Chun, der auch als Kampfkunst gilt. Die Techniken dieser Kampfstile sind darauf ausgelegt, realistische Angriffe möglichst effektiv abzuwehren und sich aus bedrohlichen Situationen zu lösen. Gerade bei militärischen Einheiten sind sie sehr gefragt, da sich mit den dort erlernbaren Techniken auf schlecht vorhersehbare Situationen vorbereiten und reagieren lässt.
Während sich aber Techniken der Kampfkunst auch im Kampfsport finden, existiert nahezu kein sportlicher Wettbewerb in den Disziplinen der Selbstverteidigung. Zugleich deutet sich dadurch bereits an: So vehement diese Bereiche in mancher Theorie auch auseinandergehalten werden, so stark überschneiden sie sich zuweilen in der Praxis. Viele Athleten trainieren nicht allein Kampfsport oder gar nur eine Disziplin, sondern auch Elemente aus den anderen Sektoren – verbinden ihre Kickboxkämpfe mit Zeremonien aus der Kampfkunst und üben zudem Krav Maga. Auch bieten viele Studios die entsprechenden Mischungen an.
Dies alles wird im Laufe des Buchs eine Rolle spielen. Denn letzten Endes ist die im Kampfsport – sowie auch in Kampfkunst und Selbstverteidigung – vermittelbare Gewaltkompetenz für diverse gewaltaffine Szenen interessant. Hier können sie lernen, mit Schlag- und Tritttechniken, mit Offensiv- und Defensivtaktiken umzugehen sowie das eigene Verhalten in Gewaltsituationen zu schulen, ihre Fitness und Reaktionen zu trainieren. Nicht ohne Grund haben sich jüngere Jahrgänge des Rockerwesens in Deutschland von einer Motorradszene zu Kickboxclubs in Kutte entwickelt. Nicht ohne Grund spielte Karate eine wichtige Rolle für die deutschen Zellen des sogenannten Islamischen Staats. Nicht ohne Grund pumpt der maoistisch-sektiererische und antisemitische „Jugendwiderstand“ seine Muskeln in den McFits zwischen Berlin, NRW und Hamburg auf. Nicht ohne Grund nutzt auch der extrem rechte „Kampf der Nibelungen“ zuweilen den Hashtag #UFC. An kaum einem Ort auf dieser Welt kommen sich faschistische Ideologien aller Herren Länder so nahe wie in manchem Gym.
Menschen aus diesen Milieus und Szenen finden sich dann auch auf den kommerziellen Events wieder. Zwischen Schaulustigen sowie Freunden der Kämpfer und Kämpferinnen gehören Neonazis, Hooligans und Rocker – je nach Region auch Islamisten – zum Standardpublikum so einiger Fight Nights – von der „Fair Fighting Championship“ in NRW bis zur „Fight Night Neubrandenburg“ in Mecklenburg-Vorpommern. Dabei unterscheidet sich das politische Bewusstsein über Haus- und Kleiderordnungen, die Auswahl der Kämpfer, zugelassene Sponsoren, Ausrüster und Einlaufmusiken bundesweit enorm:
a) Popkultur
Veranstalter wie der deutsche Marktführer „We love MMA“ wollen ihren im Durchschnitt 3.000 bis 4.000 Zuschauer*innen ein Event bieten, das auch Kampfsportfans jenseits einschlägiger Milieus erreicht, und distanzieren sich deutlich von extrem rechten Kämpfern; vorab werden die Athleten darüber informiert, dass extrem rechte Modelabels sowie diskriminierende Inhalte in der Einlaufmusik nicht erwünscht sind. Es gibt zwar Zwischenfälle, doch scheint den Organisatoren bewusst zu sein, dass der Ruch rechter Gewalt für ein gesellschaftliches Ansehen kaum förderlich ist.
b) Gewaltmilieu
Veranstalter wie die „German MMA Championship“ mit bis zu 3.000 Zuschauer*innen, aber auch kleinere Events weisen durch ihre Fightcards eine starke Nähe zu Milieus aus Türstehern, Hooligans und Rockern auf. Dementsprechend wenig Berührungsängste zeigen sie mit extrem rechten Kämpfern. Sie bilden die größte Gruppe der drei Kategorien. Proteste gegen Neonazis auf den Fightcards haben zuweilen zu deren Ausladung geführt.
c) Extreme Rechte
Der über lange Jahre geheim organisierte „Kampf der Nibelungen“ sowie das „Tiwaz“ stammen aus extrem rechten Subkulturen. Ihre Events werden von Hooligans, Rockern und Neonazis besucht. Sie dienen der Vernetzung, Finanzierung und Rekrutierung für die eigenen Strukturen. Zwar ist der KdN in keinem Verband Mitglied, doch können sie darauf zurückgreifen, dass bundesweit circa 200 extrem rechte Kampfsportler auf Wettkampfniveau trainieren, 100 bis 120 davon aus dem Umfeld des KdN. Für demokratische Diskurse und Prävention sind sie nicht erreichbar, sie verstehen sich als europäische Kämpferelite einer „weißen Rasse“. Die Veranstaltung entwickelte sich über die Jahre zu einem professionellen Event mit dem Ziel, über 1.000 Menschen anzuziehen – also das größte extrem rechte Kampfsportevent in Westeuropa zu sein. *
3. Der extrem rechte Rand der neoliberalen Fitnessbewegung
Zugleich ist dieser ausdifferenzierte Kampfsportmarkt in die enorm gewachsene, neoliberale Fitnesslandschaft integriert. Auch die Akteure des Kampfsports in der extremen Rechten haben dessen Wertekanon zutiefst verinnerlicht. Spielen wir ein kleines Quiz, um das zu verdeutlichen.
Читать дальше