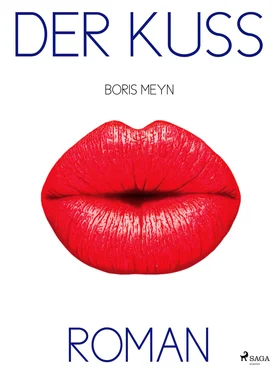In seiner Kritik war Winkler gnadenlos. Wenn ihm etwas nicht passte, riss er einem das Blatt vom Block oder Reißbrett, heftete es an die mit Kork tapezierte Wand und setzte einen dem Gespött der Klasse aus. Man brauchte ein stabiles Selbstwertgefühl, um keinen seelischen Schaden zu nehmen oder das Studium zu schmeißen.
»Schaut mal alle her!«, hieß es dann. »Apollo mit Klumpfuß« war ein beliebter Spruch für diejenigen, deren Anatomie aus den menschlichen Dimensionen geraten war. »Setzen Sie sich vor den Spiegel und porträtieren Sie sich, bis Sie begriffen haben, dass die Augenpartie die Mitte des Kopfes darstellt!«, war ein anderer Standardsatz von Winkler, den sich viele anhören mussten. Es war seine spezielle Form von Motivation, aber sie funktionierte erstaunlicherweise, denn er ließ uns nicht allein, auch wenn die Fortschritte nur in kleinen Schritten kamen. Hauptsache, man arbeitete an sich und seinem Unvermögen. Allein das zählte für ihn.
Wir akzeptierten seinen bissigen Humor auch, weil er keinen Hehl aus der Tatsache machte, dass er selbst nur wenig künstlerisches Talent mitbrachte und einer der wenigen Professoren war, der kein eigentliches oder paralleles Standbein als Künstler hatte. Sein Können beschränkte sich auf die Vermittlung, Anleitung und das Korrektorat der Lehre – und das beherrschte er vorbildlich.
Dabei war sein Name in der Stadt jedem Kunstinteressierten bekannt, denn sein Vater war seinerzeit ein bekannter Bildhauer gewesen. Dessen Werk, in erster Linie skulpturaler Bauschmuck kolossalen Ausmaßes, zierte unter anderem Brunnen, Giebel und Fassaden vieler öffentlicher Gebäude aus der Zeit der Weimarer Republik, so sie den Krieg überlebt hatten.
Unsere Klasse bestand aus vierzehn Studenten und Studentinnen, die Winkler liebevoll paritätisch wie Kinder bemutterte. Tatsächlich kamen wir uns nach kurzer Zeit wie Geschwister vor und der Kontakt blieb dementsprechend nicht auf die Unterrichtszeit beschränkt. Obwohl ich mich von vornherein in Zurückhaltung übte, war ich im Nu umschwärmt, wie ich es nicht anders gewohnt war.
Nur der Umstand, dass meine Liaison mit Julia schnell jedem Mitstudenten bekannt war, verhinderte weiter reichende Aufdringlichkeiten. Davon abgesehen, tauschten wir uns aus, verabredeten uns zum Abend, gingen gemeinsam ins Theater, ins Kino, man traf sich in Jazzkellern, in Kneipen, kurzum, ich brauchte nur wenige Wochen, um mehr Freunde um mich zu haben, als ich je gehabt hatte. Eine eigene Bleibe hatte ich noch immer nicht.
Die Stadt zu erkunden gab es nur wenig Gelegenheit, so eng war der studentische Lehrplan gesetzt. Was ich wahrnahm, sah ich im Vorübergehen oder aus der Straßenbahn – stets ein Ziel vor Augen. In Julias Wohnung war es zwar geräumig genug, aber an einen eigenen Arbeitsraum war nicht zu denken. Der einzige Raum, der hell genug war, wurde von ihrem großen Webstuhl belegt. Julia ging eigentlich nur ungern aus. Vielmehr verbarrikadierte sie sich in ihren eigenen vier Wänden und genoss unsere Zweisamkeit. Ihre Freunde hatten mit Kunst, wenn überhaupt, nur am Rande zu tun.
Zwei ihrer Freundinnen studierten an der Modeakademie. Brigitte betrieb einen Second-Hand-Laden und wurde mehr von kaufmännischen als von künstlerischen Interessen geleitet. Ein älterer Anwalt war heimlich in sie verliebt, führte sie ständig zum Essen aus und wurde zumindest als Mäzen geduldet. Er hatte Wandteppiche von Julia in seiner Kanzlei hängen. Maura war kurz davor, ihre Schneiderlehre abzuschließen. Sie arbeitete gemeinsam mit Julia in besagter Stoffabteilung des Kaufhauses, träumte von einem eigenen Label, besaß aber keinerlei Phantasie, um sich aus dem Meer bunt gebatikter Umhängefummel zu lösen, wie sie zumindest im Sommer in Mode waren.
Swantje, Anna und Mark hatten gemeinsam mit mir angefangen zu studieren. Swantje fertigte Keramiken von feingliedriger Finesse, keine plumpe Töpferware, wie sie damals in den Küchen und auf den Basttischen der Wohngemeinschaften üblich war, sondern hauchdünne elegante Porzellane, deren Gebrauchswert durch die scheinbare Zerbrechlichkeit gedämpft wurde. Ihre Vasen, Schalen und Teller ließ sie zu kostbaren Unikaten reifen, die entsprechend hochpreisig zu verkaufen waren.
Annas Bronzen – so sie überhaupt Geld für den Guss aufbringen konnte – waren dagegen Gebilde von ungestümer Wut und brachialer Wildheit. Sie zeugten von einem Zorn auf die Welt, der auch ihrem eigenen Wesen nicht fremd war. Sie war eine politisch motivierte Querulantin, die sprach, wie ihr der Schnabel gewachsen war, und sich mit jedem anlegte, der sich ihrem Weltbild der Hoffnungslosigkeit widersetzte. Sie arbeitete im Lager eines Teeversenders und versorgte uns über die Jahre mit den unglaublichsten Geschmacks- und Duftkreationen, egal ob Tee, Räucherstäbchen oder ölige Essenzen, die sie unter der Hand beschaffte.
Mark war ein liebenswerter Chaot, der eigentlich Musiker hätte werden sollen, künstlerisch mehr auf unorganisierte Noten als auf greifbare Materialien stand, sie zumindest besser zu verarbeiten wusste und das Saxophon wie einen Teil seines Körpers zu spielen beherrschte. Er besorgte uns ständig Freikarten zu Gigs und Sessions, zu denen ich dann meistens alleine ging, weil Swantje der Weg zu weit war – sie wohnte in einem der bürgerlichen Vororte im Gartenhaus einer Villa, die ihrer Großmutter gehörte, was sie uns anfangs verheimlichte. Julia waren die Örtlichkeiten meist zu verqualmt, und Anna, mit der Mark eine offene Beziehung pflegte, verpasste konsequent die Termine, weil sie am Abend meist derart zugekifft war, dass sie sich am nächsten Tag nur mit Mühe daran erinnern konnte, dass überhaupt etwas angestanden hatte.
Mark hatte ein außerordentliches Refugium an einem unglaublichen Ort. Verbotenerweise residierte er unter dem Dach eines alten Hafenspeichers, der nie zu Wohnzwecken hätte hergerichtet werden dürfen und auch keine Wohnung im eigentlichen Sinne war. Aber ein Onkel von ihm hatte ein Warenlager im Hafen, darum konnte der Dachboden über dem Lager so von ihm genutzt werden.
Es war ein magischer Ort mit einer phantastischen Aussicht über die Kräne und Lichter des Hafens. Allein die Perspektiven, die sich einem boten, wenn man nachts dem funkelnden Lichtermeer folgte, machten mich sprachlos vor Begeisterung. Das einzige Manko war: Er konnte nur nachts üben, denn tagsüber hätte ihn der Klang des Instruments verraten. Das Wohnen und Schlafen in den Speichern war strengstens verboten.
Und so saß ich dann häufig bis in die Nacht auf der provisorisch eingerichteten Dachterrasse und genoss die funkelnden Sterne des Hafens, während Mark Sonny Rollins, Charlie Parker, Stan Getz oder Paul Desmond aufleben ließ – Letzterer war von uns gegangen, als ich in die Stadt gekommen war. Da Mark von seinen Auftritten nicht leben konnte, war er ständig in Geldnot, zumal immens viel Geld für seinen Tabak draufging. Er rauchte tatsächlich Kette und steckte sich eine an der anderen an.
Ich zog ihn mit der Bemerkung auf, ob er etwa aufpassen müsse, dass sein Glimmstengel nicht ausging, wenn seine Soli bei einem Gig wieder einmal zu knapp geraten waren. Die Regel war, dass ich Essen und Getränke organisierte, wenn ich zu ihm fuhr. Auch die anderen sorgten mit Mitbringseln und regelmäßigen Einladungen dafür, dass er nicht vor die Hunde ging. Mark war so chaotisch wie Anna. In der Hinsicht passten sie hervorragend zueinander, aber während er völlig in der Musik aufging, schwebte über ihr die Gefahr, durch ihre politischen Aktivitäten aus dem Ruder zu laufen.
Anna wohnte in einer Groß-WG und ihre Mitbewohner waren zwielichtige Gesellen, die, so schien es mir, mehr auf Randale aus waren als darauf, wirkliche politische oder gesellschaftliche Konzepte zu entwickeln oder gar danach zu leben. Die nächtlichen Diskussionen bei ihr endeten meist viel zu früh, weil sich die Mehrzahl der Anwesenden nach dem dritten oder vierten Joint nicht mehr verständlich artikulieren konnte. Einer nach dem anderen kippte einfach lallend nach hinten und versank zu sphärischen Klängen oder kommunalen Rhythmen von Garcia und Consorten in der Kissenlandschaft auf dem Boden.
Читать дальше