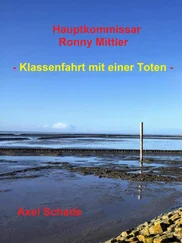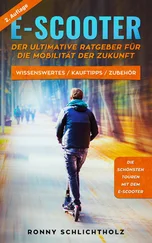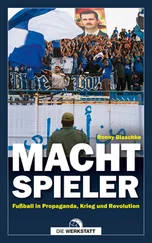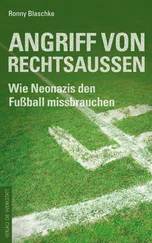Der Widerstand ging zurück, und so konnte er viele Ideen umsetzen. Schiedsrichter besuchen seitdem Schulungen gegen Gewalt, Konfliktmanager beobachten Risikospiele. Der Verband veranstaltet interkulturelle Feste und organisiert Deeskalationstraining. Liesegang dachte, er sei gut vorbereitet, doch die Konzepte helfen wenig, wenn ihn aktuelle Schlagzeilen überholen wie 2006: Rechtsextreme Zuschauer bedrohten und beschimpften im Ostberliner Stadtteil Altglienicke jüdische Spieler des TuS Makkabi in der Kreisliga. Aus Protest gegen die antisemitischen Tiraden verließen die Gäste das Feld. Die Verbandsführung gab in der Aufarbeitung eine zögerliche Haltung ab. International berichteten Medien über diese Verharmlosung, die bestehenden Konzepte wurden darin kaum erwähnt. Liesegang und seine Kollegen ließen sich in der Öffentlichkeitsarbeit schulen. Und entwarfen neue Maßnahmen: Der Verband richtete ein Postfach für anonyme Hilferufe gegen Diskriminierung ein. Er druckt Info-Broschüren in verschiedenen Sprachen, verteilt Plakate, produziert Ratgeber-DVDs. Er lädt Jura-Studierende als Jugendschöffen ins Sportgericht ein. In zwölf Jahren wurden 400 gewaltauffällige Spieler zu Einzelsitzungen geladen, nur zwei wurden rückfällig.
Viele Partner außerhalb des Fußballs
Wie groß das Netzwerk des Berliner Fußball-Verbandes geworden ist, lässt sich an einem sommerlichen Nachmittag in Tempelhof beobachten. An der nördlichen Seite des ehemaligen Flughafengeländes feiert der Verband ein Festival, das Motto: „Fairplay und Toleranz“. Zwischen Zelten und kleinen Fußballfeldern haben seine Partner Infostände aufgebaut: die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus, Polizei, Feuerwehr, Krankenkassen oder die Stadtreinigung. Gerd Liesegang ist an diesem Sonntag seit sieben Uhr unterwegs, mit mehr als 100 Helfern hat er das Fußballareal aufgebaut. Nun möchte er, dass alle mit Essen und Getränken versorgt werden, auch die Reinigungskraft vor dem Toilettenhäuschen. Liesegang strahlt, wirkt aufgedreht. Der Berliner Fußball hat seine Wurzeln in Tempelhof: 1888 wurde hier der Vereine Germania gegründet, auf dem Feld wurde schon vor mehr als 130 Jahren gekickt.
Neben Getränkewagen und Grill hat sich eine lange Schlange gebildet. Mädchen und Jungen, Frauen und Männer tragen sich in Listen ein und erhalten eine Nummer. Sie wollen einen Weltrekord von chinesischen Fußballern brechen, mindestens 1.378 Kicker sollen für zehn Sekunden ihre Bälle jonglieren. Gerd Liesegang sitzt auf einer Holzbank und schaut prüfend über das Feld. Er weiß, dass er Tradition für junge Mitglieder zeitgemäß verpacken muss. An diesem Sonntag schauen 7.000 Menschen bei dem Festival vorbei. Auch sie möchte er für die neue Fußballroute begeistern, die in Berlin zentrale Ereignisse der Berliner Fußballhistorie auf Tafeln nachzeichnet. Für Liesegang ist der Verband nicht nur ein Verwaltungsapparat, der Fußballspiele organisiert, sondern ein Anstoßgeber, der auf die Zivilgesellschaft zugehen muss, weil er nicht auf jedem Gebiet Fachwissen entwickeln kann. Liesegang pflegt Partnerschaften mit der Jüdischen Gemeinde, mit dem Lesben- und Schwulenverband Berlin-Brandenburg, mit dem Zentralrat Deutscher Sinti und Roma. „Ich hätte nicht gedacht, dass ich nach der Schule noch einmal so viel lernen würde.“
Der Berliner Fußball-Verband hat mehr als 140.000 Mitglieder, aber nur 40 hauptamtliche Mitarbeiter. Mehr als 6.000 Menschen engagieren sich in rund 400 Vereinen mit 3.300 Teams. Liesegang macht sich keine Illusionen: In vielen Klubheimen verstauben die Broschüren gegen Diskriminierung im Abstellraum. In vielen E-Mail-Postfächern von Trainern und Schiedsrichtern landet der Newsletter mit Fortbildungsterminen ungelesen im Papierkorb. In vielen Kneipen regen sich die Vereinsvertreter über „Gutmenschen vom Verband“ auf, die fast so schlimm seien wie die Krawattenträger aus dem fernen DFB-Raumschiff in Frankfurt. Auf vielen Bolzplätzen wollen Jugendliche bis tief in die Nacht kicken, aber nichts mit Schwulen-Aktivisten und Roma-Vertretern zu tun haben.
Liesegang lässt sich nicht beirren. In der Saison 2014/15 mussten in Berlin 79 Spiele wegen Gewalt oder Diskriminierung abgebrochen werden: 45 bei den Männern, 34 bei den Junioren, das entspricht 0,2 Prozent der insgesamt 34.000 Spiele. Bundesweit wurden in der Spielzeit 2014/15 von 1,2 Millionen Spielen 567 Partien abgebrochen: 0,046 Prozent. „Die Quote stagniert seit Jahren auf niedrigem Niveau“, sagt Liesegang. „Aber das sollte uns nicht beruhigen.“ Im April 2015 kam es nach dem Spiel des Berliner SC gegen Sparta Lichtenberg zu einer Massenschlägerei mit fünf Beteiligten, jemand zückte ein Messer. 2011 ging ein Schiedsrichter nach einem Faustschlag zu Boden, fast wäre er an seiner Zunge erstickt. Seit Jahren häufen sich Beschwerden von jungen Referees, die von übermotivierten Eltern angepöbelt werden. Jeden Montag geht Gerd Liesegang früh morgens zum Kiosk und kauft sich die „Fußball-Woche“, das Zentralorgan des Berliner Amateurfußballs. Bevor er sich in die Berichte vertieft, blättert er schnell durch: Wo ist es eskaliert? Wenn es Ärger gibt, dann hört das Telefon nicht mehr auf zu klingeln, dann melden sich Reporter. „Die Sprache ist rauer geworden zwischen den Jugendlichen. Der Respekt geht zurück, nicht nur im Fußball.“
Grundlegendes Misstrauen in Institutionen?
Aber wie lässt sich das Thema vermitteln, ohne die immer gleichen Schlagworte zu bemühen? Ein eiskalter Winterabend in der historischen Mitte Berlins, zwischen Staatsoper und Museumsinsel. 30 Zuschauer sitzen im kleinen „Theater im Palais“, das geschätzt wird für seine Jugendarbeit und Kulturpädagogik. Sechs Mitglieder des hauseigenen Laienensembles führen auf der Bühne „Final Countdown“ auf. Das Stück thematisiert körperliche und psychische Gewalt im Fußball. Liesegang sitzt in der vierten Reihe, er kann die Dialoge der Schauspieler fast mitsprechen. Er hat die Recherchen des Regisseurs Georg Carstens von Beginn an unterstützt. Alles, was auf der Bühne gesagt, gesungen, gebrüllt wird, hat sich auf Berliner Sportplätzen tatsächlich zugetragen. So stürmte eine erwachsene Zuschauerin auf den Rasen und zog einer elfjährigen Spielerin die Hose runter. Sie wollte nachschauen, ob da nicht doch ein Junge zum Elfmeter antritt. Bei dieser Szene geht ein bestürztes Raunen durch die Zuschauerreihen. Liesegang fühlt sich bestätigt, er möchte aufrütteln. Das Bühnenbild ist einer Umkleidekabine aus Holz nachempfunden. Man kann es leicht transportierten, und so soll das Stück auf Reisen gehen, in so manches Vereinsheim und in die Jugendstrafanstalt.
Schiedsrichter werden zum Feindbild, wenn sie die Rote Karte zücken. Lehrer werden beschimpft, wenn sie Hausaufgaben ankündigen. Politessen müssen sich Sprüche anhören, wenn sie ein Knöllchen verteilen. Es ist bequemer, Wut und Frustration online öffentlich zu machen. Und es wird aufreibender, Argumente konstruktiv einzusetzen. „Die Kommunalpolitik steckt in der Krise“, heißt es etwa in einer Studie der Bertelsmann-Stiftung. „Mitgliederschwund, Nachwuchsprobleme, sinkende Wahlbeteiligung.“ Hunderte Gemeinden tun sich schwer, einen ehrenamtlichen Bürgermeister zu finden. Eine Erhebung des Otto-Stammer-Zentrums für Empirische Politische Soziologie macht deutlich, dass die Gesamtzahl der Parteimitglieder kontinuierlich sinkt: Seit 1990 hat die CDU 40,8 Prozent ihrer Mitglieder verloren, die SPD 49,8 Prozent. Die Gewerkschaften hatten 1991 auf dem Höhepunkt ihrer Entwicklung insgesamt 11,8 Millionen Mitglieder, 2013 waren es 6,1 Millionen. In den Kirchen sind noch 60 Prozent der deutschen Bevölkerung eingeschrieben, in den 1960er Jahren waren es 90 Prozent. Mögen die Ursachen für den Schwund unterschiedlich sein, mag die Zahl der Aktiven unter den Mitgliedern weniger stark sinken, einige Fragen bleiben: Führt Politikverdruss zu einem grundlegenden Misstrauen in Institutionen? Oder können sich Bürger noch effektiver beteiligen, wenn sie sich von starren Strukturen und Hierarchien lösen?
Читать дальше