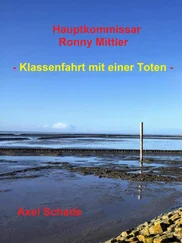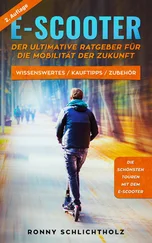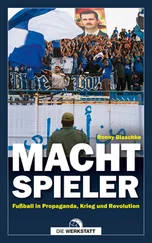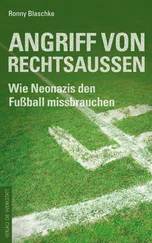In den vergangenen Jahren erschienen etliche Medienberichte und wissenschaftliche Arbeiten über Engagement im Fußball, meist über Maßnahmen gegen Diskriminierung. In der Regel wurde ein Kontrast hergestellt. Auf der einen Seite die ignorante Milliardenindustrie Fußball, auf der anderen Seite die Kritiker in der Fankurve. Doch die Fußballlandschaft ist komplexer. Das thematische Spektrum hat sich aufgefächert. Daher soll dieses Buch einen Schritt weiter gehen. Der Kern eines jedes Kapitels ist ein Thema, das die Gesellschaft in jüngerer Vergangenheit intensiv beschäftigt hat: die Flüchtlingsdebatte, der Klimaschutz oder die Gleichstellung der Frau. Zu jedem Gebiet hat der Fußball Projekte hervorgebracht. Wirkungsvolle Ansätze sollen hier vorgestellt und bloße Verschleierungsmaßnahmen entlarvt werden. Wichtig: die kritische Einordnung und der Blick über den Sport hinaus. Im bürgerschaftlichen Engagement kann der Fußball nicht isoliert betrachtet werden von Politik, Wirtschaft und Kultur.
Es kann nicht darum gehen, wie das Fußballgeschäft zur Beschwichtigung der Öffentlichkeit etwas Geld an Projekte überträgt. Eine zeitgemäße Gesellschaftspolitik prägt alle Strukturen und lagert das soziale Gewissen nicht an Stiftungen aus. In der Bundesliga kommt diesem Ansatz nur der SV Werder nahe. Die Bremer haben nachgewiesen, dass die Identifikation durch ein seriöses Engagement steigt, bei Fans, Sponsoren, Kommune und vor allem: bei den eigenen Mitarbeitern. Es wird noch einige Jahre dauern, bis diese Qualität in der Bundesliga zu einem Mindeststandard wird. Die englische Premier League ist da professioneller aufgestellt. Dieses Buch soll eine Debatte anstoßen und Experten für einen Austausch zusammenbringen. Nicht der zynische Blick auf den enthemmten Profifußball soll im Vordergrund stehen. Wichtig sind die konstruktiven Projekte, die den Kern des Sports verändern könnten. Die Nachahmung: ausdrücklich erwünscht. Damit der Begriff „Nachhaltigkeit“ bald nicht mehr wie eine Floskel klingt.
Die europäischen Fußballligen setzen jährlich mehr als 20 Milliarden Euro um. In der Bundesliga liegt der Gesamtumsatz bei mehr als zweieinhalb Milliarden, möglich durch ein Geflecht aus Konzernsponsoring und Medienverwertung. Die deutschen Klubs überweisen allein eine Milliarde an Spieler und Trainer. Diese Summen stehen in keinem Verhältnis zur tatsächlichen Bedeutung. Der Fußball ist ein Unterhaltungsbetrieb, der für die Grundbedürfnisse unseres Lebens entbehrlich ist. Doch gerade weil er so ernst genommen wird wie kein anderes entbehrliches Gut, muss er mehr in die Gesellschaft zurückspielen. Nicht das Konto ist dafür entscheidend, sondern die Kompetenz. Dadurch würde der Fußball nicht weiter wachsen, aber er könnte einen anderen Wert für sich beanspruchen: Relevanz.
Mehr Ehre als Amt
30 Millionen Deutsche engagieren sich freiwillig, die meisten im Sport. Im Fußball kommen so jährlich 120 Millionen Arbeitsstunden zusammen – und eine Wertschöpfung von fast zwei Milliarden Euro. Eine Symbolfigur ist Gerd Liesegang. Als Vizepräsident des Berliner Fußball-Verbandes entwickelt er Konzepte gegen Gewalt. Doch immer weniger Mitglieder wollen wie er dauerhaft einen Posten übernehmen. Wie kann das Ehrenamt im demografischen Wandel gestützt werden?
Gerd Liesegang hat Schlüsselrecht. Im Eingangsbereich der Jugendstrafanstalt Berlin wirft er den Beamten hinter den vergitterten Scheiben einen freundlichen Blick zu. Sie kennen sich, sie schätzen sich. Zweimal im Monat ist Gerd Liesegang in der JVA zu Gast. Er muss sich nicht anmelden, er gehört zu den Vertrauenspersonen für Häftlinge und Personal. Liesegang kennt die Fußballplätze der Hauptstadt so gut wie nur wenige, doch an diesen kann er sich schwer gewöhnen. Der Rasen ist umgeben von grauen Betonmauern. 120 junge Frauen und Männer spielen an diesem Nachmittag um den Sepp-Herberger-Pokal. Die zehn Teams kommen aus sieben Bundesländern, die meisten Spieler wurden zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt.
Gerd Liesegang, ein Mann von kräftiger Statur, steht am Rand neben der Eckfahne und diskutiert mit Sozialarbeitern. „Was gibt’s Neues?“, fragt der Vizepräsident des Berliner Fußball-Verbandes, des BFV. „Seid ihr immer noch unterbesetzt?“ Mehr als 4.000 Gefangene befinden sich in Deutschland im Jugendstrafvollzug. Die 27 Gefängnisse sind oft überlastet, viele Insassen leiden an Bewegungsarmut. Wissenschaftler beschreiben Sport als wichtiges Element der Resozialisierung. Auf diesem Feld ist die Sepp-Herberger-Stiftung aktiv. Sie ist vor Ort auf Partner angewiesen, die mit Politik und Fußball vernetzt sind, auf Partner wie Gerd Liesegang.
Das Turnier ist für die Teilnehmer der Jahreshöhepunkt, doch auch sonst motiviert Liesegang immer wieder Vereine und Mannschaften, in die JVA zu kommen. Sie bestreiten Freundschaftsspiele, Trainingseinheiten, tauschen ihre Erfahrungen aus. „Die Spieler, die von außen kommen, werden hier sehr nachdenklich“, sagt er. „Viele von ihnen wollen Profifußballer werden und leben in einer Scheinwelt. Hier merken sie: das richtige Leben sieht anders aus. Man muss sich durchbeißen, man muss mit Niederlagen leben, man muss manchmal von vorn anfangen.“
Vor den Finalspielen des Herberger-Pokals nehmen die Teams im Veranstaltungssaal der Strafanstalt Platz. Zwei Mitglieder der Musikgruppe „Söhne Mannheims“ sprechen über Motivation. Anschließend stellen Mitarbeiter ihre Projekte vor. Die Gefangenen können eine Schiedsrichter- oder Trainerausbildung absolvieren, auch Bewerber und Anti-Gewalt-Training. Im Zentrum steht die spätere Eingliederung ins Arbeitsleben. Gerd Liesegang sitzt im Beirat der JVA. Dort spricht er mit Pädagogen, Anwälten, Arbeitsvermittlern. Er hat Vereine gewonnen, die Gefangene nach der Haft als Mitglieder aufnehmen. Auf Vertrauensbasis, ohne Getratsche. Er hat sich nach Ausbildungsplätzen umgehört, auch nach Praktika. Er wurde mitunter enttäuscht von den Jugendlichen. Einige sind nicht am Arbeitsplatz erschienen, haben im Verein für Ärger gesorgt oder sind schnell wieder in der JVA gelandet. „Davon will ich mich nicht entmutigen lassen“, sagt Liesegang. „Vielen können wir langfristig helfen.“
Was wäre die Gesellschaft ohne Ehrenamt? In Gemeinden, Kirchen, Feuerwehren. In Volkshochschulen, Bildungsstätten, Feriencamps. In Erste-Hilfe-Kursen, Altersheimen, Fahrgemeinschaften. 31 Millionen Menschen im Alter ab 14 Jahren engagieren sich in Deutschland, ohne einen finanziellen Nutzen davon zu haben – ein Bevölkerungsanteil von 44 Prozent. Das ergab der vierte Freiwilligensurvey, die größte Untersuchung zur Zivilgesellschaft in Deutschland, die seit 1999 alle fünf Jahre durch das Bundesfamilienministerium in Auftrag gegeben wird.
Diese Zivilgesellschaft wird von 620.000 Organisationen getragen, von Vereinen, Stiftungen oder Genossenschaften. Es gibt 580.000 Vereine, siebenmal so viele wie vor 50 Jahren. In den mehr als 90.000 Sportvereinen sind 8,6 Millionen Menschen aktiv, Trainer, Betreuer oder Platzwarte. In keinem Bereich der Gesellschaft betätigen sich so viele Ehrenamtliche wie im Sport. Bei einem fiktiven Stundenlohn von 15 Euro beträgt ihr Beitrag zur jährlichen Wertschöpfung mehr als sechs Milliarden Euro. Das legt der Sportentwicklungsbericht nahe, der alle zwei Jahre erscheint, herausgegeben durch den Deutschen Olympischen Sportbund, das Bundesinstitut für Sportwissenschaft und die Sporthochschule Köln. Eine Symbolfigur dieser Fleißarbeit ist Gerd Liesegang. Als Vizepräsident des Berliner Fußball-Verbandes entwirft er Konzepte gegen Gewalt und für Vielfalt im Sport. Seit mehr als 40 Jahren ist er dem Fußball verbunden – er stützt das Gemeinwohl seiner Heimatstadt.
Im östlichen Teil von Kreuzberg, nicht weit von der Spree entfernt, erinnert heute nicht viel an den tristen Kiez aus den 1960er Jahren, in dem Gerd Liesegang aufgewachsen ist, 500 Meter von der Mauer entfernt. In einem Neubau hatte er sich mit seinen Geschwistern ein Zimmer geteilt. Sein Vater war Busfahrer, seine Mutter Reinigungskraft. Gerd Liesegang, 1956 geboren, folgte seinem älteren Bruder und trat mit zwölf Jahren dem Berliner Ballspielclub Südost bei, dem BBC, einem von damals fünf Vereinen in Kreuzberg. Er war Verteidiger, doch sein Talent lag außerhalb des Platzes. Mit 13 trainierte er die dritte D-Jugend-Mannschaft, sein erstes Spiel ging verloren, 1:7 gegen Tasmania. Die Klubräume lagen in einer ehemaligen Kaserne, die schrittweise abgerissen wurde. Der Verein musste von einem düsteren Raum in den nächsten ziehen. Liesegang verstand früh, dass er wichtige Partner braucht, er wollte seine Leidenschaft nicht in Ruinen ausleben.
Читать дальше