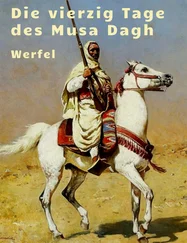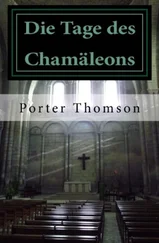„Das sind also unsere beiden neuen Küchenhilfen, Fräulein Hobbes und Fräulein Mietzner“, werden sie von der Leiterin des Kinderheimes begrüßt und den anderen Mitarbeitern vorgestellt. „Hier geht alles nur mit dem Vornamen, klar? Das dient der Arbeitserleichterung und schafft eine einzige große Familie. Also, wie werdet ihr gerufen?“
„Renate.“
„Anne.“
Die Arbeit im Kinderheim hatte Spaß gemacht. Kartoffeln schälen und Zwiebeln schneiden, Gemüse putzen, Tische decken und abräumen, servieren und den Riesenabwasch machen. Alles Tätigkeiten, bei denen man sich unterhalten konnte oder auch Radio hören, singen und lachen. Und zwischendurch an den Strand gehen, gleich hinterm Haus, und sich von der Sonne rösten oder von den Wellen umwerfen lassen. Genau wie die Kurgäste. Und das kostenlos. Nicht einmal Kurtaxe bezahlen müssen, diesen unvermeidlichen Extrazoll, über den die anderen am Strand so oft schimpften. Und bei alledem noch das angenehme Gefühl zu haben, daß man etwas Sinnvolles tut. Daß man hilft, wo Hilfe nottut. Was wollten wir noch mehr?
An einem der ersten Abende in ihrem kleinen Zimmer – Anne und Renate haben ihre Betten übereinander – beugt Renate sich hinunter und flüstert: „Du, Anne, jetzt weiß ich, wie das gemeint ist, wenn man sagt: Nur was man für andere tut, tut man für sich. Irgendeiner hat das doch mal so schön ausgedrückt.“
„Ja, – war das nicht Max Stirner?“
„Der? – Nein, ich glaub mehr Albert Schweitzer oder so einer.“
„Jedenfalls hat er das schön gesagt.“
„Und jedenfalls hat er recht damit, das spüre ich jetzt ganz deutlich.“
Die beiden wohnen nicht in dem Kinderheim, in dem sie arbeiten, sondern privat. Soweit auf Juist überhaupt noch irgendwas als privat zu bezeichnen ist, formulieren sie ihre Zweifel an dieser Benennung. In der viel zu kurzen Saison wird an die Gäste vermietet, was sich nur vermieten läßt. Und die kleinste Ecke im Keller oder unterm Dach wird noch zum Komfortdoppelzimmer hochgejubelt, wenn auch die Betten übereinander sind. Das gilt als typisch Schiffskoje, bringt also zusätzliches Lokalkolorit, verstehen sie – und müßte eigentlich noch einen Aufschlag kosten. Aber in dem Haus hier ist man zum Glück nicht so, freuen sie sich. Im übrigen kriegen sie schon zu spüren, daß die Eingeborenen der Insel auf eine lange Strandräubertradition zurückblicken. In ihrer nicht so richtig geregelten Freizeit merken die beiden bald, daß die Preise in einem erschreckenden Kontrast zu ihrem Taschengeld stehen. Kino? – Zu teuer. Friseuse? – Unbezahlbar. Ausflugsfahrten? – Glatt zu vergessen. Da bleibt gerade mal ein Eis auf die Hand. Oder eine Cola. Die kann man lange stehenlassen. Und ein Taschenbuch hin und wieder, das ja nur die Hälfte kostet, weil sie es beide lesen, das muß sein. Aber wie sie dann diese Seife im Schaufenster sehen, da müssen sie sich jede ein Stück kaufen, denn erst in der Kombination ist das ja ein unwiderstehliches Angebot. Das eine Stück trägt die Aufschrift CRAZY und das andere SPLEEN. Das, meinen sie ausgelassen lustig, das passe haargenau zu ihnen.
Und jetzt weiß ich nicht mehr, wer von uns welches Stück Seife bekommen hat. Egal. Ist ja kein großer Unterschied zwischen den beiden Bezeichnungen. Wie wir beide auch nicht sehr verschieden waren. Ein bißchen verrückt sein, das konnten wir beide. Wie ich eines Tages Renate überrascht habe mit meiner Idee: „Wir könnten ein Versandgeschäft aufmachen.“
„Ein Versandgeschäft? – Mit was denn?“
„Mit Pferdeäpfeln. Davon liegen hier doch genügend herum. Und die werden uns jeden Tag frisch geliefert, sogar kostenlos.“
„Ja, und zuhause in Berlin, die Laubenpieper, die würden sich die Finger danach lecken.“
„Puh, allein schon diese Vorstellung.“
Wir konnten uns halbwegs kaputtlachen. Über nichts und alles. Wenn wir nicht gerade sehr ernsthaft dabei waren, dem Guten im Menschen auf die Beine zu helfen. Ja, diese sechs Wochen auf Juist, das war meine schönste Zeit, dachte Annemarie Kleine Sextro. Und sicher würde Renate das genauso sehen. Renate – jetzt hier in meiner Nähe. Gefangen, eingesperrt im Hochsicherheitstrakt. Noch um etliches scheußlicher untergebracht als ich in meinem bloß schäbigen Richterzimmerchen. – Nur keine Tränen! So würde Renate mich jetzt zur Ordnung rufen.
Und flüchtete sich sofort wieder in die Vergangenheit: Das war für uns beide das erste Mal ein Leben in einer völlig anderen Welt. Wahrhaftig eine Insel der Seligen. Ohne Autos, ohne Fabriken. Das romantisch klingende Pferdegetrappel auf den Straßen, auf dem rotbraunen Klinkerpflaster. Und die Luft, die nach Meer roch und nach Salz schmeckte. Und Tag für Tag dieser frische Wind. Immer noch kürzer hatten wir uns die Haare geschnitten, gegenseitig. Wie Leichtmatrosen sähen wir aus, hatte die Heimleiterin gesagt. Wie hieß sie noch? – Dreßen. Frau Dreßen. Eine mütterlich-mollige Frau und bei aller aufgesetzten Berufsstrenge so was von gutmütig. Und die Kinder, behinderte Kinder, körperlich und teilweise auch geistig behindert, die waren restlos glücklich, wenn wir sie in den Bollerwagen packten und mit ihnen querfeldein rasten und sie plötzlich einfach in den Sand kippten.
Die Angestellten sahen das nicht so gern. Sie verwiesen auf ihre spezielle Ausbildung und ihre Prüfungen. Sie wüßten, wie solche Problemfälle zu behandeln sind. Und wir verstanden überhaupt nicht, wieso es um Problemfälle gehen sollte. Für uns waren das einfach unbeschwert fröhliche Kinder. Wie wir selbst. „Deshalb wohl“, sagte die Richterin vor sich hin.
Wie wir uns ereifert haben über die Predigt des Pfarrers. Speckeisen nannten wir ihn. Weil er so ähnlich hieß, wir seinen Namen aber nicht gleich richtig verstanden hatten. Der Dialekt der Inselleute machte uns doch Schwierigkeiten. Und nachzufragen, daran dachten wir überhaupt nicht. Noch schöner, nein, noch schöner könnte er wirklich nicht ausfallen, der Name eines fetten Pfarrers. Damals ging ich ja noch gelegentlich in den Sonntagsgottesdienst. Genau wie Renate. Ein überraschend moderner Klinkerbau mit einem wuchtigen Turm über dem Haupteingang. Der stand da wie der letzte Stummel eines bald völlig verbrauchten überdimensionierten Zimmermannsbleistifts. Himmelsschreiber, ja, so nannten wir diesen Kirchturm. – Aber wie Pfarrer Speckeisen die Frauen um Jesus dargestellt hat, das schrie zum Himmel. Fanden wir wenigstens. Wobei wir ausnahmsweise einmal verschiedener Meinung waren.
Da erzählt so ein Pfarrer auf der Nordseeinsel Juist, wie Jesus im fernen Palästina in einem Dorf von einer Frau namens Marta eingeladen wird, zu ihr nachhause zu kommen und ihr Gast zu sein. Irgendwie bringt er das auf die bekannte Formel: Komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns bescheret hast. „Das ist so üblich gewesen damals“, sagt er, „als es noch keine Hotels und Pensionen und christlichen Hospize gab. Leute, die wie Jesus predigend umherzogen, waren stets darauf angewiesen, daß ein lieber Mitmensch sich so für sie begeisterte, daß er sie in sein Haus einlud. Die Marta“, so Speckeisen, „war zwar solch eine begeisterte Zuhörerin, aber nur, bis sie es geschafft hatte, den vielbestaunten Prediger zu ihrem Gast zu machen. Von dem Moment an hatte sie für ihn kein Ohr mehr. Sie kümmerte sich nur noch um die Bereitung des Essens. Sie wollte ihm nämlich zeigen, was für eine perfekte Gastgeberin sie war. Ganz anders ihre Schwester Maria, die mit ihr in dem Haus wohnte. Die setzte sich zu Füßen des Meisters nieder und lauschte aufmerksam seinen Worten. Und als Marta sich nach einer Weile bei Jesus beschwerte, daß ihre Schwester nur dasitze und ihr die ganze Arbeit überlasse, und ihn bat, er möge sie anweisen, ihr ein bißchen zur Hand zu gehen, da mußte die gute Frau sich sagen lassen: ,Marta, Marta, du kümmerst dich zuviel um Unwichtiges. Deine Schwester Maria hat den besseren Teil gewählt.‘
Читать дальше