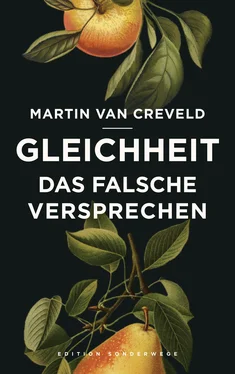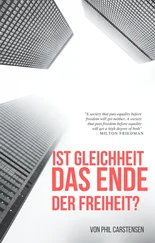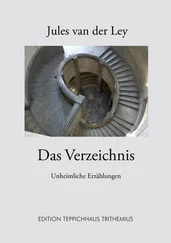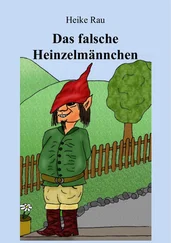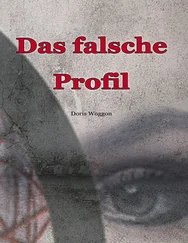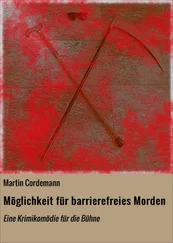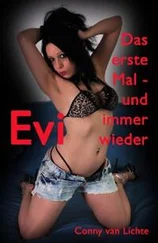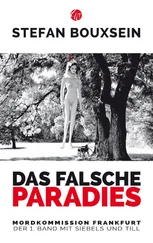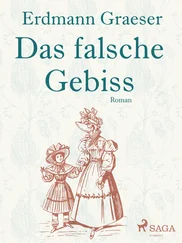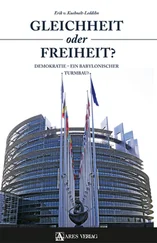Bis hierher haben wir uns mit der Ungleichheit zwischen Individuen und Clans innerhalb von gegebenen Gesellschaften beschäftigt. Gehen wir nun einen Schritt weiter: Wenige, wenn überhaupt nur die einfachsten Gesellschaften betrachten ihre Nachbarn als ihnen selbst ebenbürtig. Der eponyme Begriff Dinka – er bezeichnet also sowohl den Stamm als auch die Sprache, die seine Mitglieder sprechen – bedeutet einfach nur »Volk«. Die Nachbarn der Dinka, die Nuer, sehen das natürlich genau umgekehrt. Die treffendste Übersetzung für das Wort Bantu , das überall in Afrika weit verbreitet und in Varianten als Watu oder Batu oder Bato oder Abantu oder Vanhu oder Vandu ausgesprochen wird, lautet angeblich einfach »Menschen«. Die implizite Annahme, dass alle anderen sub-human oder unmenschlich sind, ergibt sich daraus fast von selbst. Auch Lokono , der Name eines karibischen Volkes und seiner Sprache, bedeutet »Volk«. Die Blackfoot-Indianer in Alberta und Montana nannten sich selbst Niitsítapi , das »ursprüngliche Volk«. Der Name mehrerer Eskimo-Gruppen auf beiden Seiten der Beringstraße, Yupik, ist ein Kompositum, das sich aus dem Wort yuk für »Person« und dem Suffix -pik für »wahr« oder »ursprünglich« zusammensetzt; die wörtliche Bedeutung lautet also »wahres Volk«. 24
Während die Völker sich selbst als überlegen bezeichneten, verwiesen die Namen, mit denen sie andere benannten, auf deren Unterlegenheit. Die Sotho-Tswana-Sprachen in Südafrika etwa erweitern die Namen anderer Völker regelmäßig mit dem Präfix Ama , das »unvertraut« bedeutet. Die Griechen nannten Fremde barbaroi – Barbaren. Impliziert war damit, dass sie nicht korrekt sprechen konnten und weniger vollständig menschlich waren. Wie Aristoteles es später formulierte, waren sie »Sklaven von Natur«, die sich nicht selbst regieren konnten, sondern einen Herrn benötigten (despotes ; das griechische Wort kann sowohl einen Sklavenbesitzer, als auch einen politischen Anführer bezeichnen), der natürlich hoch über seinen Untergebenen stand und alles andere als ihnen gleich war. 25Wir kennen andere Beispiele zuhauf. Wahrscheinlich gab es kaum einen Clan, einen Stamm oder eine Nation, deren Mitglieder sich selbst nicht als Krone der Schöpfung betrachteten. Damit aber sahen sie die meisten oder vielleicht sogar alle Fremden als ihnen selbst unterlegen. In wissenschaftlichen Studien wurden die Teilnehmer willkürlich in Gruppen eingeteilt und sollten gegen entsprechende Gruppen konkurrieren. Obwohl die Mitglieder jeder Gruppe einander kaum kannten und die der gegnerischen Gruppe erst recht nicht, entwickelten sie schnell ein Überlegenheitsgefühl. Vielleicht bewiesen sie damit, dass wir genau hierfür programmiert sind. 26
Ob Hordengesellschaften »gut« oder »schlecht« sind, hängt davon ab, aus welcher Perspektive man sie betrachtet. Aufklärerische Forschungsreisende und die philosophes , die deren Berichte lasen und die Wirklichkeit für sie interpretierten, lebten selbst in einer höchst ungleichen Gesellschaft. Angefangen mit dem König, lasteten die Oberklassen mit aktiver Unterstützung der Kirche schwer auf den unteren Klassen im zurecht so genannten »fiskal-militärischen Staat«. 27Viele von ihnen waren große Bewunderer der Gleichheit und damit der Freiheit von Unterdrückung, die die »Wilden« in fernen Ländern angeblich genossen. Band für Band feierten sie deren Einfachheit, Ehrlichkeit, Mut, Großzügigkeit (auch in dem Sinn, dass sie ihre Frauen teilten und sie jedem gaben, der sie wollte), kurz: das Edle in ihnen. Ein perfektes Beispiel für dieses Genre ist Diderots Nachtrag zu Bougainvilles Reise . Dieser Text von 1772 war zu seinen Lebzeiten verboten, wurde erst nach der Revolution veröffentlicht und schnell zum Klassiker. Noch bekannter war Jean-Jacques Rousseau (1712–1778). Er fasste das Thema kurz und knapp zusammen: »Der Mensch ist frei geboren, und überall liegt er in Ketten.« 28
Die Reisenden, Imperialisten und Ethnografen des 19. Jahrhunderts neigten zur entgegengesetzten Ansicht. Die Sitten insbesondere im Bereich der Sexualität, die ihre Vorgänger als edel und erhaben interpretiert hatten, erschienen ihnen bestialisch. Wie für Rousseau war für sie ein »Wilder« wie der andere und besaß keinerlei Autorität über andere. So wurden die Gemeinschaften, in denen sie lebten, im abwertenden Sinn als »Horden«, also als wilde Haufen verstanden. Ihnen fehlte die Organisation, die für kollektive Handlungen in größerem Maßstab und insbesondere für die Errichtung und Erhaltung einer feinteiligen Zivilisation vonnöten war. Anerkannt wurde freilich, dass individuelle »Hordenmenschen« gut gebaut, stark und sehr tapfer sein konnten. So bewerteten zum Beispiel viele Europäer die Maori, auf die sie in Neuseeland trafen. 29Der berühmte englische Reisende und Romancier Henry Rider Haggard (1856–1924) beschrieb die kenianischen Massai als »grausam oder ehrfurchtsgebietend«, »unglaublich riesig … und schön, aber doch irgendwie zierlich gebaut; aber mit dem Antlitz eines Teufels«. 30Als Winston Churchill über die Derwische schrieb, gegen die er 1896 in Omdurman kämpfte, konnte er ihren Mut gar nicht hoch genug loben. 31Und doch bewirkte die sozio-ökonomische Gleichheit, welche sich nun einmal in schwache politische Autorität übersetzte, dass sie leicht zu erobern und noch leichter zu unterjochen waren.
Eine dritte Gruppe, die Sozialisten, schlugen eine Art Mittelweg ein. Die meisten von ihnen waren erbitterte Gegner des europäischen Kolonialismus auf anderen Kontinenten. Stattdessen entschieden sie sich, in der Nachfolge Rousseaus die Nichtexistenz von Privateigentum und den egalitären Charakter der einfachsten ihnen bekannten Gesellschaften zu feiern. Marx persönlich wandte sich in einigen seiner frühen Schriften explizit gegen die »Entfremdung«, die die »Teilung der Arbeit« mit sich brachte. 32Andererseits waren die Realistischeren unter ihnen, darunter auch Marx in späteren Jahren, sich durchaus der Tatsache bewusst, dass ein solcher Egalitarismus mit den Bedürfnissen einer komplexen Industriegesellschaft inkompatibel ist. Wäre er unter Zwang durchgesetzt worden, so wären mit Sicherheit neunzig Prozent der Menschen in dieser Zivilisation innerhalb weniger Jahre schlicht verhungert. Wenn Marx von der Zukunft sprach, ging es ihm nicht einfach nur um die Reproduktion irgendeiner idealisierten Stammesvergangenheit. Das Privateigentum an Produktionsmitteln sollte in der Tat abgeschafft werden. Doch die sich dann entwickelnde Gesellschaft sollte doch auf einem viel höheren Niveau funktionieren als ihre vorsintflutlichen Vorläufer. 33
Im Rückblick ist klar, dass sich alle, die sich in dieser Debatte zu Wort meldeten, getäuscht haben. Eine genauere Prüfung der Fakten hätte ergeben, dass es Horden von vollkommen freien Männern und Frauen mit gleicher Autorität, gleichem Status und gleichem Zugang zu sämtlichen Ressourcen einschließlich einvernehmlicher Sexualität nie gegeben hat und wahrscheinlich nie hätte geben können. Um Hobbes zu paraphrasieren, vollkommene Gleichheit kann wie ihr Pendant, die vollkommene Freiheit, nur existieren, wenn jeder Einzelne allein in der Wüste wohnt – und dort ist sie bedeutungslos. Sogar die einfachsten bekannten Gesellschaften beruhten in erheblichem Ausmaß auf Ungleichheit. Zwar gab es keine festen sozialen Klassen oder Institutionen, doch die unterschiedlichen Menschen steckten fest in häufig extrem komplexen Gefügen aus Rechten und Pflichten, geschuldeter und erwarteter Respektsbezeugung. Der geschuldete Respekt, die jeweiligen Rechte und Pflichten differenzierten nach Alter und Geschlecht. Dass es einige Individuen gab, die häufig wegen ihres Alters und/oder eines angenommenen Zugangs zum Göttlichen gegenüber den anderen privilegiert waren, war ein anerkanntes Faktum. Genauso wichtig war die Fähigkeit, etwa bei Überfällen und im Krieg die Führung übernehmen zu können.
Читать дальше