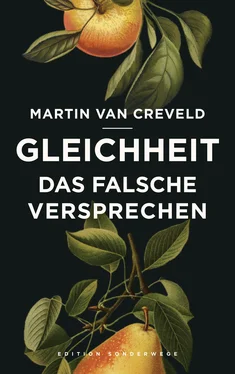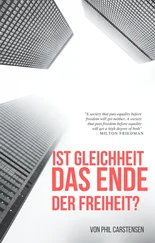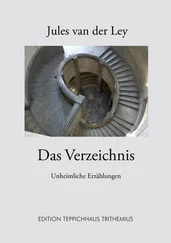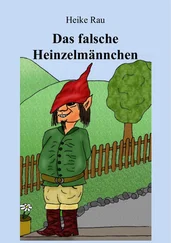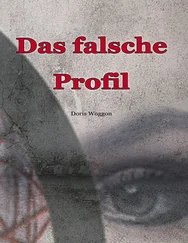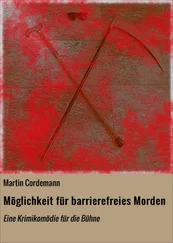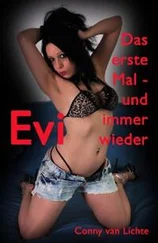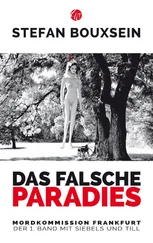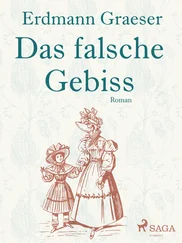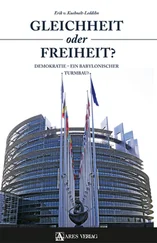Was Sklaven angeht, so kennen wir keinen Vorschlag eines antiken Autors, die Ungerechtigkeit dieser Situation anzuerkennen und Sklaven in die Bürgerschaft aufzunehmen. Falls es dazu doch kam, und das nicht nur in Sparta, sondern auch in anderen Städten, geschah das aus reiner Notwendigkeit; und zuweilen brachte es die betreffenden Staatswesen an den Rand des Bürgerkriegs. Bei Frauen dagegen lag die Sache anders. Verschiedentlich wurde die Möglichkeit diskutiert, Frauen gleiche Rechte zuzugestehen. Einen Beitrag leistete etwa der große Komödiendichter Aristophanes. In seiner Ekklesiazousai oder »Weibervolksversammlung« entwarf er eine imaginäre Polis unter der von Frauen bestellten Herrschaft von Frauen. Eigentum wäre dort stets Gemeinschaftsbesitz, die ökonomische Arbeit würde wie in Sparta von Sklaven geleistet. Innerhalb der Bürgerschaft würde sexuelle Exklusivität abgeschafft, so dass auch die hässlichsten Vertreter beider Geschlechter gleiche Chancen hätten, mit den bestaussehenden Individuen des anderen Geschlechts ins Bett zu gehen. Wahrscheinlich wollte Aristophanes mit diesem Stück die Idee der Gleichheit einschließlich der Gleichheit der Frau kritisieren, indem er sie bis ins Absurde überzeichnete. Auch Platon diskutierte recht ausführlich die Emanzipation der Frauen. Um es den Frauen zu ermöglichen, die Staatsangelegenheiten gleichberechtigt mitzugestalten und selbst als Wächterinnen mitzuwirken, schlug er vor, ihnen die gleiche Erziehung zukommen zu lassen wie den Männern. Wie so viele Feministinnen nach ihm wollte auch er sie von der Pflicht »befreien«, sich um die Kinder zu kümmern. Wahrscheinlich erschienen ihm diese Vorstöße gerecht, nützlich, ja sogar wesentlich, aber leider utopisch. Letzten Endes erklärte jedenfalls keine griechische Polis je die Frauen zu Vollbürgern oder dehnte den Begriff der Freiheit so weit, dass Frauen den Männern gleichgestellt gewesen wären.
Sowohl in Sparta als auch in Athen war die Gleichheit, in welcher genauen Form auch immer, stets exklusiv. Innerhalb jeder Polis galt sie nur für einen recht kleinen Teil der Bevölkerung. Nach außen hin wurde sie sorgsam gehütet, so dass es für Fremde extrem schwierig war, Zugang und Teilhabe daran zu erhalten. In Athen wurde das mit der Zeit sogar schwieriger statt einfacher. Gelegentlich gab es Versuche, den Kurs zu wechseln, die aber regelmäßig scheiterten. 53Im Hellenismus bildeten einzelne Städte lose Bündnisse und gestanden den Bürgern der Bündnispartner eingeschränkte Rechte zu. Wie heute die Europäische Union, kamen sie aber einer gemeinsamen Bürgerschaft nie auch nur nahe. Die Bürger verstanden sich nie nur als zufällig zusammengewürfelte Gruppe, sondern sprachen sich irgendeine Form einer gemeinsamen Abstammung zu. 54Die heilige Aufgabe jeder Polis bestand darin, dieses Erbe zu verteidigen, das ihr Kernstück darstellte, sie von den anderen unterschied und ihre Existenz rechtfertigte. Als Aristoteles seine Schüler aussandte, um die »Verfassungen« oder politeiai von nicht weniger als 158 Städten zu sammeln, meinte er damit nicht nur die jeweilige politische Struktur, sondern auch die Organisation ihres sozialen, kulturellen und selbst religiösen Lebens. Wäre das Material erhalten geblieben, so hätte es ein unvergleichliches Bild aller Aspekte der griechischen Zivilisation in allen signifikanten Städten ergeben – doch leider besitzen wir nur noch den Band über Athen.
Die interne Exklusivität bedeutete, dass innerhalb jeder Polis nur ein Teil der Bevölkerung gleiche Rechte genoss. Auch handelte es sich nicht um eine Demokratie nach heutigem Verständnis. Sowohl in der Antike als auch später gingen manche noch weiter und erklärten, der bestehende Grad an Gleichheit sei auf Kosten der Freiheit (in Sparta) und der Stabilität (in Athen) gegangen. Für andere war sie ohnehin nur eine Täuschung; nämlich lediglich ein Instrument, über das eine relativ kleine Gruppe von Menschen – erwachsene männliche Bürger – alle anderen beherrschte. Externe Exklusivität dagegen hieß, dass es strenge Grenzen gab, wie groß eine Polis werden konnte, ohne sich selbst preiszugeben. Diese Exklusivität ist ein wichtiger Aspekt, um zu erklären, warum die Stadtstaaten in außenpolitischen Belangen und im Krieg nur begrenzten Erfolg hatten und schließlich anderen, größeren und mächtigeren Staatsformen wichen. Die Gleichheit war hier erstmals in der Geschichte als bewusstes und in gewissem Ausmaß auch umgesetztes Ideal aufgetaucht, doch am Ende geriet diese Flamme ins Flackern und erlosch. Völlig vergessen aber wurde sie nie, und ihre Wirkungsmacht ist bis heute omnipäsent.
KAPITEL 3
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.