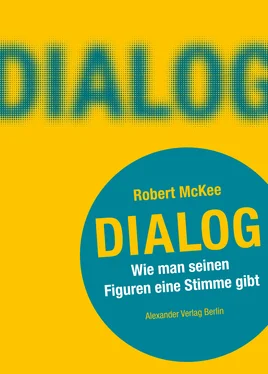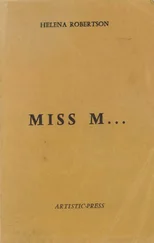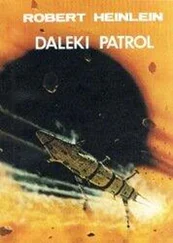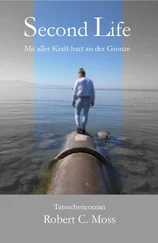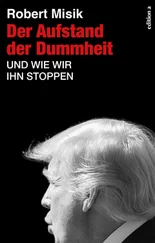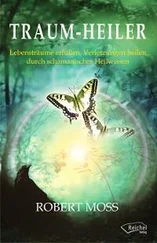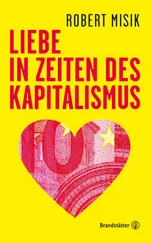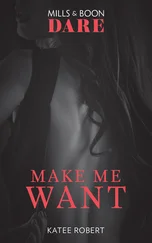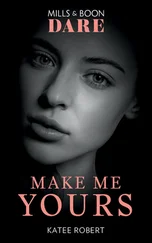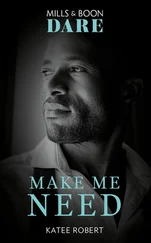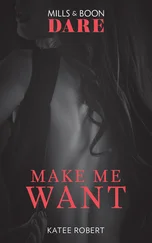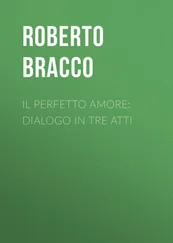Glücklich, wie die Schwangerschaft sie machte, wurde sie nachlässig und sprach Alfred auf das Falsche an. Natürlich nicht auf Sex oder Erfüllung oder Fairness. Es gab noch andere, kaum weniger verbotene Themen, und in ihrem Leichtsinn ging Enid eines Morgens zu weit. Sie meinte, er solle Aktien eines gewissen Unternehmens kaufen. Alfred sagte, der Aktienmarkt sei gefährlicher Unfug, den man am besten reichen Männern und faulen Spekulanten überlasse. Enid meinte, er solle trotzdem Aktien eines gewissen Unternehmens kaufen. Alfred sagte, er erinnere sich an den Schwarzen Dienstag, als sei der gestern gewesen. Enid meinte, er solle trotzdem Aktien eines gewissen Unternehmens kaufen. Alfred sagte, es gehöre sich nicht, diese Aktien zu kaufen. Enid meinte, er solle sie trotzdem kaufen. Alfred sagte, sie hätten kein Geld übrig, schon gar nicht jetzt, da sich ein drittes Kind ankündige. Enid meinte, sie könnten sich Geld leihen. Alfred sagte nein. Er sagte es mit wesentlich lauterer Stimme und stand vom Frühstückstisch auf. Er sagte so laut nein, dass eine Kupferschale, die das Küchenregal zierte, flüchtig summte, und verließ, ohne Enid einen Abschiedskuss gegeben zu haben, für elf Tage und zehn Nächte das Haus. 9
Durch die fünfmalige Wiederholung des Verbs »meinte« rückt Franzen Enids Nörgelei und Alfreds Zorn in die Nähe einer Farce. Die Formulierung »elf Tage und zehn Nächte« verweist auf die spätere Kreuzfahrt, und das Bild von der flüchtig auf dem Regal summenden Schale führt die Szene über die Farce hinaus ins Absurde.
Und da indirekte Dialoge ihre Leser dazu einladen, sich die Szene vorzustellen, wird aus der hitzigen, womöglich sogar melodramatischen Sprache des direkten Dialogs die persönlichere, glaubhaftere Version des jeweiligen Lesers.
2
DIE DREI FUNKTIONEN VON DIALOGEN
Dialoge, ob nun dramatisch oder narrativ, erfüllen drei grundlegende Funktionen: Exposition, Charakterisierung und Aktion.
Der Fachbegriff der Expositionbezeichnet die fiktiven Fakten zum Setting, zur Vorgeschichte und zu den Figuren, die den Lesern/Zuschauern irgendwann vermittelt werden müssen, damit sie der Story folgen, sich auf sie einlassen können. Es gibt nur zwei Möglichkeiten für Autoren, eine Exposition in ihre Erzählung einzubetten: als Beschreibung oder als Dialog.
Auf Bühne, Leinwand und Bildschirm übersetzen Regisseure und ihre Ausstatter bzw. Szenografen die Beschreibungen des Autors in lauter nichtdialogische Ausdrucksträger: Kulissen, Kostüme, Licht, Requisiten, Ton etc. Comiczeichner und Verfasser von Graphic Novels illustrieren ihre Story beim Erzählen. Prosaautoren gestalten literarische Beschreibungen, die Wortbilder in die Fantasie ihrer Leser projizieren.
Das Gleiche können auch Dialoge bewirken. Stellen Sie sich einmal Folgendes vor: eine goldglänzende Marmor-Lobby, blonde Besucher in Business-Kleidung, die sich an von Uniformierten bewachten Sicherheitsschaltern melden, Aufzugtüren, die sich im Hintergrund geschäftig öffnen und schließen. Sobald wir dieses Bild sehen, transportiert es sofort eine Reihe expositorischer Fakten: das Setting (ein Bürogebäude in einer Großstadt irgendwo auf der nördlichen Erdhalbkugel), die Zeit (zwischen acht Uhr früh und sechs Uhr abends an einem Werktag), die Gesellschaftsschicht (eine jener Berufsgruppen der westlichen Kultur, die uniformierte Wachleute engagiert, um die Führungskräfte im obersten Stock von der Armut unten auf der Straße abzuschirmen). Außerdem suggeriert der Subtext des Bildes eine kompetitive, weiß und männlich dominierte Geschäftswelt, ein Streben nach Reichtum und Macht, immer hart an der Grenze zur Korruption.
Jetzt stellen Sie sich einen hochenergetischen Investment-Broker beim Mittagessen mit einem potentiellen Kunden vor. Hören Sie auf die Andeutungen, die in seinen aalglatten Zweideutigkeiten impliziert sind: »Kommen Sie mit hoch und lernen Sie meine jungen Falken kennen. Unser Horst befindet sich im 77. Stock, unser Jagdrevier ist die Wall Street.« Mit weniger Zeichen als ein üblicher Tweet legt dieses Wort-Bild mehr Dimensionen offen, als die Kamera jemals einfangen kann.
Im Dialog kann praktisch alles impliziert werden, was sich in Bildern ausdrücken oder im Fließtext der Erzählung erläutern lässt. Daher besteht die erste Dialog-Funktion auch darin, den lauschenden Lesern/ Zuschauern die Exposition zu liefern. Diese schwierige Aufgabe wird von folgenden Prinzipien gesteuert:
Tempo (Pacing) und Timing
Tempo (Pacing) bezeichnet die Frequenz oder die Häufigkeit, mit der die Exposition in die Erzählung eingespeist wird. Timing bedeutet, die genaue Szene und die exakte Textstelle innerhalb dieser Szene auszuwählen, um eine bestimmte Tatsache aufzudecken.
Tempo und Timing einer Exposition sind mit einigen Risiken behaftet: Bietet man den Story-Rezipienten zu wenig Exposition, wenden sie sich verwirrt ab. Im Gegenzug ersticken zu große Brocken statischer Exposition aber auch das Interesse: Leser lassen das Buch sinken, Zuschauer rutschen unruhig auf ihren Plätzen umher und wünschen sich, sie hätten mehr Popcorn gekauft. Bei Tempo und Timing im Platzieren von Expositionen sind also Sorgfalt und Fingerspitzengefühl gefragt.
Um das Interesse wachzuhalten, teilen gute Autoren ihre Exposition in einzelne Häppchen auf und vermitteln immer nur das, was die Zuschauer oder Leser gerade wissen müssen, und zwar nur in dem Moment, in dem dieses Wissen absolut notwendig und gewollt ist. Keine Sekunde vorher. Sie bieten nur das absolute Minimum an Exposition, das nötig ist, um Neugier und Empathie weiter fließen zu lassen.
Wenn Sie heutigen, mit allen Story-Wassern gewaschenen Lesern/Zuschauern zu schnell zu viel Exposition präsentieren, erlahmt nicht nur ihre innere Beteiligung, sie ahnen auch lange im Voraus sämtliche Wendepunkte und sogar das Ende. Dann sitzen sie verärgert und enttäuscht vor Ihrer Arbeit und denken sich: »Das habe ich kommen sehen.« Wie es Charles Reade, ein Schriftsteller aus dem 19. Jahrhundert, so schön formuliert hat: »Lass sie lachen, lass sie weinen, lass sie warten.«
Zu guter Letzt sind auch nicht alle expositorischen Fakten von gleich hohem Wert für die Erzählung und verdienen daher nicht gleich viel Aufmerksamkeit. Führen Sie eine separate Datei, in der Sie alle Fakten Ihrer Story auflisten, und sortieren Sie sie danach, wie wichtig sie für Ihre Leser/Zuschauer jeweils sind. Im Lauf des Überarbeitens und Feilens stellen Sie dann vielleicht fest, dass manche Fakten stärker betont und in mehr als einer Szene wiederholt werden müssen, um sicherzustellen, dass die Leser/Zuschauer sich am entscheidenden Wendepunkt auch daran erinnern. Andere, weniger wichtige Fakten müssen dagegen vielleicht nur einmal kurz gezeigt oder angedeutet werden.
Der Grundsatz »Zeigen, nicht sagen« (»Show, don’t tell«) warnt vor Dialogen, die dynamische Darstellung durch passive Erklärungen ersetzen wollen. Zeigenheißt, eine Szene in einem authentischen Setting zu präsentieren, sie mit glaubhaften Figuren auszustatten, die nach der Erfüllung ihres jeweiligen Wunsches streben, aus dem Moment heraus wahrhaftige Aktionen durchführen und dabei glaubwürdige Dialoge sprechen. Sagenbedeutet, die Figuren dazu zu zwingen, ihr Vorhaben zu unterbrechen und stattdessen ausführlich über ihre Lebensgeschichte, ihre Gedanken und Gefühle oder ihre aktuellen und früheren Vorlieben und Abneigungen zu berichten, obwohl es keinerlei szenen- oder figurenimmanenten Grund dafür gibt. Storys sind Metaphern für das Leben und keine Abhandlungen über Psychologie, Umweltkrisen, soziale Ungerechtigkeit oder andere Themen, die mit dem Leben der Figuren nichts zu tun haben.
Читать дальше