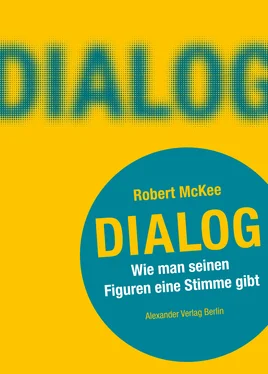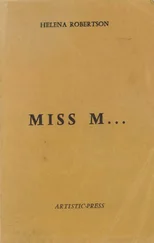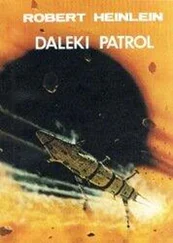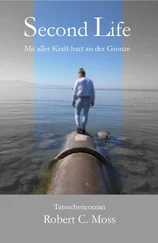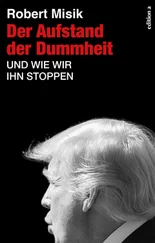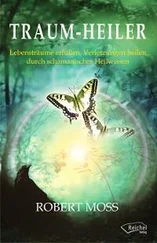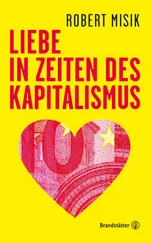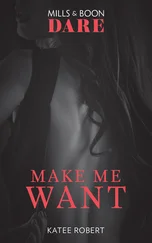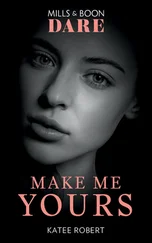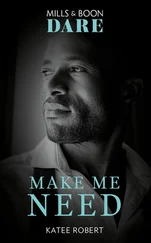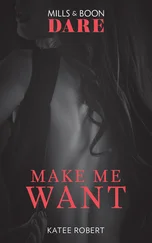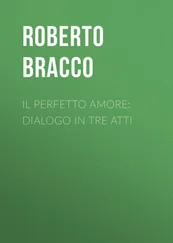Die objektive Erzählinstanz(die wir auch als verborgene oder neutrale Erzählinstanz bezeichnen könnten) zeigt mehr als sie sagt. Sie beobachtet, analysiert aber nicht. Wie ein Zuschauer im Theater des Lebens lehnt dieses erzählende Bewusstsein sich gemütlich zurück, dringt nie in die inneren Bereiche vor, beschreibt weder die Gedanken noch die Gefühle der Figuren. Berühmte Beispiele dafür sind Ernest Hemingways Kurzgeschichten, unter anderem Hügel wie weiße Elefanten und Schnee auf dem Kilimandscharo . Mitte des 20. Jahrhunderts führte der französische Nouveau Roman die Technik in Werken wie Die Jalousie von Alain Robbe-Grillet bis an ihre äußersten Grenzen.
Die subjektive Erzählinstanzdringt bis ins Innenleben vor und kann auch zwischen den Gedanken und Gefühlen mehrerer Figuren hin und her wechseln. Häufig beschränken sich Autoren allerdings auf das Innenleben des Protagonisten oder der Protagonistin der jeweiligen Erzählung. Mitunter weist diese Instanz gewisse Ähnlichkeiten mit der Ich-Erzählung auf, wahrt aber den Abstand durch Verwendung der Personalpronomen »er« und »sie« statt »ich«.
In George R. R. Martins Lied von Eis und Feuer -Reihe nimmt beispielsweise jedes Kapitel einen anderen Handlungsstrang auf und beschränkt sich dabei auf den POV des jeweiligen Protagonisten.
Im 20. Jahrhundert wurde die Technik des subjektiven Erzählens, sowohl in der begrenzten (personalen) als auch in der allwissenden (auktorialen) Variante, zur beliebtesten Erzählperspektive in der Prosa. Eine subjektive Erzählinstanz kann durchaus eine gewisse Persönlichkeit und Meinungen aufweisen, die sie offen vertritt (vgl. den unten zitierten Abschnitt aus Die Korrekturen ), aber wie spielerisch oder sarkastisch, wie vertraut oder persönlich sie auch erscheinen mag, die Stimme ist immer die Schöpfung einer Autorin oder eines Autors, eine bestimmte Dimension ihrer selbst, die sie sich ausgedacht haben, um die Story von einem Standort jenseits der Ereignisse zu vermitteln.
Unter Umständen kann ein Autor sich auch entscheiden, seine Erzählinstanz den Vertrauenspakt brechen zu lassen, den viele Jahrhunderte Lyrik und Prosa zwischen Autoren und ihren Lesern geknüpft haben. In seltenen Fällen haben Autoren diese Stimme mit figurenartigen Zügen wie Verwirrtheit und Hinterhältigkeit ausgestattet. Doch auch hier gilt: So manipulativ, unzuverlässig oder unsicher eine auktoriale oder personale Erzählinstanz geraten mag, ihre Sprache ist kein Dialog. Es ist der Autor, der hinter einer Maske spricht. Erzählungen in der 3. Person erfordern ganz eigene Strategien und Techniken, die den Rahmen dieses Buches sprengen würden.
Du-Erzählung:Hinter der Du-Erzählung verbirgt sich entweder ein Ich-Erzähler oder eine auktoriale oder personale Erzählinstanz. Bei dieser Erzählperspektive beseitigt die erzählende Stimme sowohl das Pronomen »ich« als auch die Pronomen »er/sie/sie (Plural)« und spricht stattdessen jemanden mit »du« an. Es kann sich bei diesem »Du« auch um den Protagonisten oder die Protagonistin selbst handeln. Wenn sich beispielsweise jemand in Gedanken mit »Du Idiot!« beschimpft, kritisiert ein Teil seines Ichs einen anderen. Die Stimme einer Du-Erzählung kann also analytisch, ermutigend oder nostalgisch sich selbst gegenüber sein ( Paris-Rom oder Die Modifikation von Michel Butor). Manchmal ist das »Du« aber auch eine schweigende, namenlose andere Figur, die die Erzählung in einen einseitigen dramatischen Dialog verwandelt ( A Song of Stone von Iain Banks). Oder – die dritte Möglichkeit – das »Du« ist der Leser, die Leserin. In Jay McInerneys Roman Ein starker Abgang führt ein schwer fassbares Bewusstsein den Leser im Präsens durch die Handlung, bis er das Gefühl hat, die Ereignisse selbst zu durchleben:
Du weißt nicht genau, wo du hinläufst. Du hast das Gefühl, dir fehlt die Kraft, um nach Hause zu gehen. Du gehst schneller. Wenn das Sonnenlicht dich noch auf der Straße zu fassen kriegt, wird eine schreckliche chemische Reaktion in dir ablaufen.
Nach ein paar Minuten bemerkst du das Blut an deinen Fingern. Du hältst dir die Hand vors Gesicht. Auch auf deinem Hemd ist Blut. Du findest ein Papiertaschentuch in der Jackentasche und hältst es dir unter die Nase. Mit in den Nacken gelegtem Kopf gehst du weiter. 7
Würde man diesen Absatz im Präteritum neu schreiben und das »Du« durch »ich« ersetzen, hätte man eine ganz konventionelle Ich-Erzählung; ersetzte man das »Du« durch »er«, käme ein konventioneller, auktorial oder personal erzählter Roman dabei heraus. Die Gegenwartsform in der 2. Person macht die Erzählung zu einem Zwitterwesen aus beidem und schafft eine filmartige Atmosphäre, die an subjektive Kameraführung erinnert.
Um diesen komplexen Sachverhalt noch etwas klarer zu machen, wollen wir die Prosakonventionen mit ihren Entsprechungen auf Bühne, Leinwand und Bildschirm vergleichen.
Dramatische Prosa-Szenen können in allen drei Erzählperspektiven verfasst sein: als Ich- oder Du-Erzählung bzw. als Erzählung in der 3. Person. Bei allen drei Stimmen spielen sich die Szenen in ihrem jeweiligen zeitlichen und räumlichen Setting ab, die Figuren und ihr Verhalten werden beschrieben, ihre Gespräche wörtlich wiedergegeben. Es wäre denkbar, solche Szenen aus dem Buch zu nehmen und sie mehr oder weniger unverändert auf eine Theaterbühne oder in ein Filmstudio zu bringen, wo sie von Schauspielern dargestellt würden.
Alles, was außerhalb einer dramatischen Szene von einem Ich- oder Du-Erzähler geäußert wird, ist nach meiner Definition narrativer Dialog. Die entsprechenden Passagen werden figural gesprochen, also aus einer Rolle heraus, mit dem Zweck, die Story voranzubringen, und wirken auf die Leser ganz ähnlich wie ein Monolog auf der Bühne oder eine Wendung zur Kamera. Wenn ein narrativer Dialog in einen Stream of Consciousness übergeht (vgl. unten), lesen sich die Buchseiten wie ein innerer Monolog in einem Theaterstück oder wie das Voiceover der Protagonisten in Filmen wie Memento oder Pi – System im Chaos . In allen Fällen ist der Autor beim Schreiben in einer Rolle.
Alle vier wichtigen Story-Medien lassen ihren Autoren die Wahl, sich entweder an Szenen aus der Vergangenheit zu erinnern und diese zu beschreiben oder sie den Lesern/Zuschauern direkt zu präsentieren, sie darzustellen. Wählen sie die Beschreibung, verwandelt sich eine potenzielle Szene mit dramatischem Dialog in einen indirekten Dialog.
Lässt der Autor eine seiner Figuren eine vorangegangene Szene beschreiben, so paraphrasiert die unmittelbare Äußerung dieser Figur die frühere Äußerung einer anderen Figur. In der folgenden Passage aus Bruce Norris’ Stück Clybourne Park beschwert sich Bev über ihren Mann.
BEV: … wenn er die ganze Nacht aufbleibt. Letzte Nacht hat er um drei Uhr früh einfach hier gesessen (…) und ich sage zu ihm, sag mal bist du nicht müde? Willst du ein Sominex nehmen oder vielleicht Karten spielen, aber er sagt, warum sollte ich , als müsste es irgendwelche großartigen Gründe für alles geben, was man so [macht]. 8
Das Publikum kann nur vermuten, wie korrekt ihre Paraphrase ist, aber es ist in diesem Kontext auch gar nicht wichtig, was genau gesagt wurde. Norris nutzt den indirekten Dialog dazu, sein Publikum das eigentlich Wichtige hören zu lassen: wie Bev das Verhalten ihres Mannes in ihren eigenen Worten interpretiert.
Paraphrasiert eine außenstehende Erzählinstanz Dialoge, müssen die Leser ebenfalls darauf schließen, wie sie geklungen haben könnten, als sie direkt geäußert wurden. Nehmen wir beispielsweise die folgende Szene zwischen einem Ehepaar aus Jonathan Franzens Roman Die Korrekturen :
Читать дальше