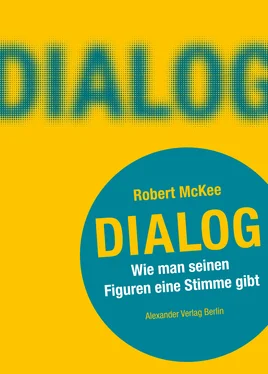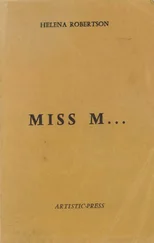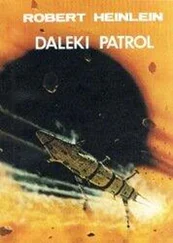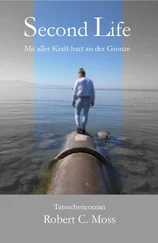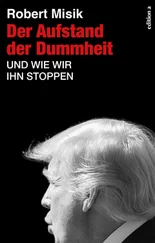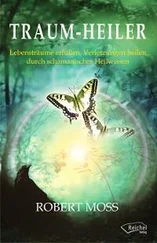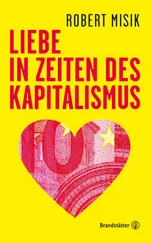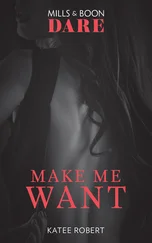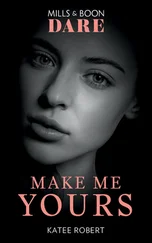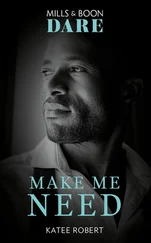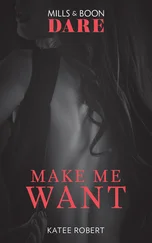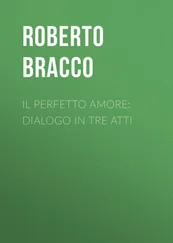Das Theater beispielsweise ist ein vorwiegend akustisches Medium. Es hält die Zuschauer dazu an, aufmerksamer zuzuhören als zuzusehen. Entsprechend stellt die Bühne die Stimme über das Bild.
Beim Kino ist es umgekehrt. Film ist vor allem ein visuelles Medium. Es hält die Zuschauer dazu an, aufmerksamer zuzusehen als zuzuhören. Aus diesem Grund stellen Drehbücher das Bild über die Stimme.
Die Fernsehästhetik bewegt sich zwischen Theater und Kino. Drehbücher für Fernsehfilme behandeln Bild und Stimme ausgewogen, laden uns zu etwa gleichen Teilen zum Zusehen und Zuhören ein.
Prosa ist ein mentales Medium. Während die Storys, die auf Bühne und Leinwand aufgeführt werden, die Augen und Ohren der Zuschauer direkt erreichen, nimmt die Literatur den indirekten Weg über den Geist ihrer Leser. Diese müssen zunächst die Sprache interpretieren, sich dann die beschriebenen Anblicke und Geräusche vorstellen (wobei jede Leserin und jeder Leser eine eigene Vorstellung hat) und sich schließlich erlauben, auf das Vorgestellte zu reagieren. Mehr noch: Da für literarische Figuren keine Schauspieler nötig sind, steht es ihren Autoren frei, so viel oder so wenig Dialog zu verwenden und ihn so dramatisch oder narrativ zu gestalten, wie sie es jeweils für richtig halten.
Schauen wir uns einmal an, wie ein Story-Medium den Dialog formt.
DIALOG AUF DER BÜHNE
Dramatischer Dialog
Bei allen vier großen Story-Medien ist die Szene die Grundeinheit der Erzählstruktur. Im Theater wird der allergrößte Teil der Sprechstücke in dramatischem Dialog umgesetzt, der von Figuren in Szenen mit anderen Figuren aufgeführt wird.
Auch das Einpersonenstück ist da keine Ausnahme. Wenn eine einsame Figur auf der Bühne auf- und abgeht, kreiert sie dabei Szenen aus dramatischen inneren Dialogen, indem sie sich gewissermaßen zweiteilt und ihre verfeindeten Ichs aufeinander loslässt. Wenn sie sich zurücklehnt und ihren Gedanken freien Lauf lässt, stellen sich ihre Erinnerungen, Fantasien und Ansichten am besten als innere Aktionen dar, die von einem Wunsch geleitet sind und einem bestimmten Zweck dienen. So passiv und ziellos solche Grübeleien oberflächlich betrachtet auch wirken mögen, in Wahrheit sind sie doch dramatische Dialoge, in einer Szene von einer konfliktbeladenen Figur geäußert, die mit sich selbst darum ringt, sich zu verstehen, die Vergangenheit zu vergessen, sich von einer Lüge zu überzeugen – oder was Theaterautoren sonst noch an inneren Aktionen einfällt. Samuel Becketts Das letzte Band kann als brillantes Beispiel für einen dramatischen Dialog in einem Einpersonenstück dienen.
Gemäß einer uralten Theaterkonvention dürfen Bühnenautoren auch den narrativen Dialog einsetzen und ihre Figuren aus dem Szenenfluss heraustreten und sich ans Publikum wenden lassen, entweder in einem Monolog oder, wenn es nur ganz kurz ist, in einem Beiseitesprechen. 6Oft wird dabei ein Geständnis gemacht, ein Geheimnis enthüllt oder aber die wahren Gedanken, Gefühle oder Vorhaben einer Figur, die sie den anderen Figuren gegenüber nicht äußern kann. Die qualvollen Selbstanklagen von Tom Wingfield in Tennessee Williams’ Glasmenagerie sind ein Beispiel dafür.
In Ein-Personen-Inszenierungen wie Das Jahr magischen Denkens , Mark Twain Tonight! und I Am My Own Wife wird aus dem Monolog ein ganzes Stück. Solche Werke sind oft Bühnenadaptionen von Biographien oder Autobiographien, und die Schauspieler spielen darin beispielsweise eine bekannte Zeitgenossin (Joan Didion) oder eine historische Persönlichkeit (Mark Twain). Im Lauf des Abends können sie dabei alle drei Formen der Figurenrede einsetzen. Meistens aber lassen sie das Publikum in narrativem Dialog an ihrer Geschichte teilhaben. Hin und wieder stellen sie auch andere Figuren dar oder spielen Szenen aus der Vergangenheit in dramatischen Dialogen nach.
Die heutige Standup-Comedy fand ihre Form, als sich die Komiker vom bloßen Witzeerzählen ab- und dem narrativen Dialog zuwandten. Standup-Comedians müssen entweder eine Figur erfinden (wie Stephen Colbert) oder eine selektive, typisierte Version ihrer selbst auf die Bühne bringen (wie Louis C. K.), denn kein Mensch kann als genau die Person auf die Bühne kommen, als die er am Morgen aufgestanden ist. Ein Auftritt erfordert eine Kunstfigur.
Auf der Bühne kann sich die Grenze zwischen dramatischem und narrativem Dialog auch verschieben, je nachdem, wie die Schauspieler ihre Rolle interpretieren. Wenn Hamlet beispielsweise seine weitere Existenz in Frage stellt, richtet er die Äußerung »Sein oder Nichtsein« dann an das Publikum oder an sich selbst? Die Entscheidung liegt beim Schauspieler.
In Fällen, bei denen die Story eines Theaterstücks eine große Zahl von Figuren über mehrere Jahrzehnte hinweg umfasst, platzieren Dramatiker mitunter einen Erzähler am Bühnenrand. Diese Nicht-Figuren können alle möglichen Aufgaben erfüllen: Sie übernehmen die historische Exposition, führen andere Figuren ein oder begleiten die Handlung kontrapunktisch mit Ideen oder Interpretationen, die sich in den Szenen nicht direkt darstellen lassen.
Einige Beispiele: In Donald Halls Stück An Evening’s Frost (die Lebensgeschichte des Dichters Robert Frost) und Erwin Piscators epochaler Bühnenadaption von Tolstois Krieg und Frieden präsentieren die Erzählerfiguren auf der Bühne dem Publikum ein gottgleiches Wissen über Geschichtliches und die Figuren des Stücks, sie haben aber keinerlei persönliche Wünsche. Sie stehen über der Handlung, vereinfachen die Narration. Im Gegensatz dazu vermischen sich die Funktionen bei Thornton Wilders Erzählerfigur in Unsere kleine Stadt , dem sogenannten Spielleiter. Er übernimmt die Exposition und beeinflusst die Haltung des Publikums, hin und wieder begibt er sich aber auch in die dramatischen Szenen hinein und übernimmt eine kleine Rolle darin.
DIALOG AUF LEINWAND UND BILDSCHIRM
Dramatischer Dialog
Wie beim Theater besteht auch der Löwenanteil der Gespräche in Film und Fernsehen aus dramatischen Dialogen, die als Rolle und im realen Agieren vor der Kamera oder – im Animationsfilm – aus dem Off eingesprochen werden.
Film- und Fernsehfiguren können ihre Dialoge auf zweierlei Weisen narrativ gestalten: entweder als Voiceover aus dem Off, das über die Bilder gelegt wird, oder als Monolog direkt in die Kamera.
Figuren, die aus dem Off von sich selbst erzählen, gehören seit den Anfängen des Tonfilms zum Inventar. Manchmal sprechen sie mit ruhiger, logischer und vertrauenswürdiger Stimme (How I Met Your Mother) , manchmal zetern sie auch einfach hysterisch, irrational und unglaubwürdig los (Pi – System im Chaos) . Manchmal geben sie verwirrenden Ereignissen einen Sinn (Memento) , und manchmal bilden sie den Kontrapunkt zum Geschehen (The Big Lebowski) . Einige Figuren offenbaren im dramatischen Dialog mit ihrem inneren Ich schmerzhaft ehrliche Gedanken (Adaption) , andere verstecken ihr geheimes Ich hinter Ausreden und Rechtfertigungen (A Clockwork Orange) , und wieder andere kommentieren ihre Zwangslage mit geistreichen Bemerkungen (My Name Is Earl) .
Wenn eine Figur direkt in die Kamera schaut und uns etwas Geheimes, Persönliches zuflüstert, ist das meistens eine eigennützige Taktik, um uns auf ihre Seite zu ziehen (House of Cards) . Seit Bob Hope wenden sich Comedians mit kurzen Sätzen und Blicken zur Kamera, um den Witz zu verstärken (It’s Garry Shandling’s Show) . Und Woody Allen, der Größte von allen, setzt narrativen Dialog sowohl aus dem Off als auch vor der Kamera ein, um sich unsere Empathie zu sichern und Gags anzustacheln (Der Stadtneurotiker) .
Читать дальше