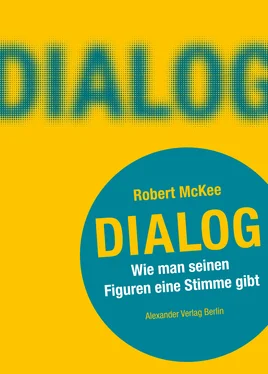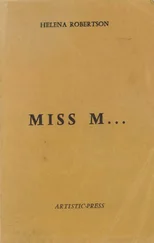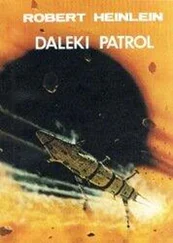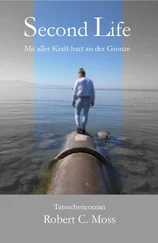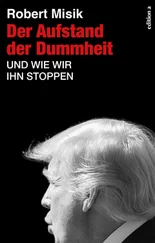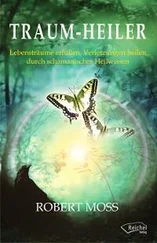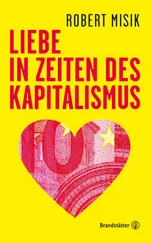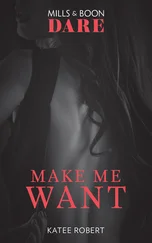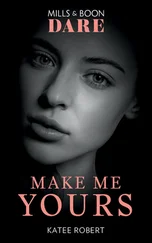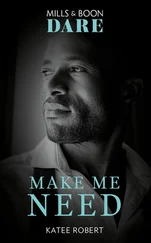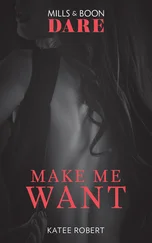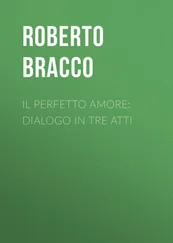In Licht im Winter von Ingmar Bergman schickt eine Frau (gespielt von Ingrid Thulin) ihrem ehemaligen Liebhaber (Gunnar Björnstrand) einen Brief, in dem sie über seine Feigheit spricht und seine Unfähigkeit, sie zu lieben. Als der Mann zu lesen beginnt, schneidet Bergman auf das Gesicht der Frau in Nahaufnahme, und sie spricht den Brief, den Blick dabei direkt in die Kamera gerichtet, sechs Minuten lang. Bergmans subjektive Kameraführung führt uns direkt in die Fantasie des Ex-Liebhabers, so dass wir uns mit ihm und seinem Leiden identifizieren können, während er seine einstige Geliebte sprechen sieht und hört; zugleich lässt Ingrid Thulins Spiel mit der Kamera die intime Vertrautheit der beiden wieder aufflackern.
In Filmen wie Barry Lyndon , Die fabelhafte Welt der Amélie und Y Tu Mamá También – Lust for Life stellen Erzählerfiguren (Sir Michael Hordern, André Dussollier bzw. Daniel Giménez Cacho), die mit sonorer, wortgewandter Stimme aus dem Off erzählen und nicht zur Handlung gehören, die Verbindung zwischen einzelnen Episoden her, liefern die Exposition und bilden einen Kontrapunkt zum Handlungsverlauf.
Kontrapunktisches Erzählenbringt Ideen und Einsichten von außen in die fiktive Welt ein, um der Handlung mehr Dimension und Tiefe zu verleihen. So kann ein Erzähler einer Komödie tragisches Gewicht geben oder eine Tragödie mit Komik auflockern, er kann Illusionen mit Realität und Realität mit Fantastereien durchsetzen, seine Kommentare spielen die Welt der Politik gegen das Reich des Privaten aus oder umgekehrt. Oft genug bewahren die ironischen Beobachtungen dieser Nicht-Figuren einen Film davor, ins Sentimentale abzugleiten, indem sie die Gefühlsduselei der Figuren untergraben. Tom Jones – Zwischen Bett und Galgen ist ein Beispiel dafür.
Storys, die auf Bühne, Leinwand oder Bildschirm dargestellt werden, bewegen sich in den physischen Medien Luft und Licht und gelangen über die Sinne – Hören und Sehen – schließlich in den Geist. Storys, die in Prosa dargestellt werden, bewegen sich im mentalen Medium der Sprache, um in der Fantasie ihrer Leser zum Leben zu erwachen. Und da die Fantasie sehr viel komplexer, facettenreicher und vielschichtiger ist als die Sinne, hat die Literatur auch vielfältigere und flexiblere Dialogtechniken zu bieten als Theater, Fernsehen oder Kino.
Storys in Prosa können entweder von einer Figur aus der Handlung heraus erzählt werden oder aber von einer Erzählinstanz, die außerhalb der Story steht. Diese schlichte Unterteilung wird allerdings durch die drei POVs (Point of View) verkompliziert, die in der Literatur zur Auswahl stehen: Ich-Erzählung, Du-Erzählung, Erzählung in der 3. Person.
Ich-Erzählung: In einer Ich-Erzählung berichtet eine Figur, die selbst Gegenstand der Geschichte ist, dem Leser in der »Ich«-Form von Ereignissen, an die sie sich erinnert. Sie kann diese Ereignisse beschreiben oder sie dramatisch als Abfolge von Szenen präsentieren, in denen sie direkte Gespräche mit anderen Figuren führt. Sie kann sich aber auch nach innen wenden und mit sich selbst reden. Ist das der Fall, so folgen ihr die Leser dorthin und belauschen sozusagen ihr Selbstgespräch.
Ich-Erzähler sind immer auch als Figuren an der Story beteiligt und daher unzuverlässige Zeugen des Lebens, das um sie herum stattfindet, sie können das Geschehen nicht in seiner Gesamtheit überblicken und sind häufig alles andere als objektiv, weil sie ihre unausgesprochenen oder unbewussten Wünsche verfolgen. Aus diesem Grund kann die Glaubwürdigkeit von Ich-Erzählern ein breites Spektrum von ehrlich bis trügerisch abdecken.
Zudem sind Ich-Erzähler häufig sehr viel mehr auf sich selbst konzentriert als auf andere, so dass ihre inneren Aktionen, ihre Selbstbeobachtungen und Grübeleien die Buchseiten dominieren. Auf das Innenleben anderer Figuren lässt sich folglich nur aus den Vermutungen des Ich-Erzählers schließen oder aus Andeutungen, die sich den Lesern zwischen den Zeilen offenbaren.
Ein allwissender Ich-Erzähler mit übermenschlicher Einsicht in die Gedanken und Gefühle anderer Figuren kommt nur höchst selten zum Einsatz. So viel Dünkel erfordert eine außergewöhnliche Begründung. So ist in Alice Sebolds Roman In meinem Himmel die Ich-Erzählerin der Geist eines ermordeten Mädchens, das aus seiner jenseitigen Perspektive auf die Welt hinuntersieht und in die Herzen seiner Angehörigen blicken kann, die mit dem Verlust zu kämpfen haben.
Ich-Erzähler können selbst die Protagonisten der Story sein (wie Tony Webster in Julian Barnes’ Vom Ende einer Geschichte ), sie können Vertraute der Protagonisten sein (wie Dr. Watson für Sherlock Holmes), sie können jedoch auch eine Gruppe sein, die in der ersten Person Plural spricht ( Die Selbstmord-Schwestern von Jeffrey Eugenides), oder aber distanzierte Beobachter (so wie der namenlose Erzähler in Joseph Conrads Herz der Finsternis ).
Erzählung in der 3. Person:Bei einer Erzählung in der 3. Person führt eine Erzählinstanz die Leser durch die Ereignisse. Oft verfügt diese Instanz über einen tiefen Einblick in die Gedanken und Gefühle sämtlicher Figuren. Obwohl das erzählende Bewusstsein selbst keine Figur ist, kann es doch mit starken moralischen oder anderweitigen Ansichten über die fiktive Welt und deren Gesellschaft aufwarten. Trotzdem wahrt es traditionell den Abstand, indem es von den Figuren als »er«, »sie« und »sie« im Plural spricht.
Da es sich bei dieser Erzählinstanz in der 3. Person nicht um eine Figur handelt, ist ihr Bericht kein Dialog. Es handelt sich aber auch nicht um die niedergeschriebene Stimme der Autorin oder des Autors. Niemand, nicht einmal der wortgewandteste Talkshow-Gast, geht mit der Stimme einer Erzählinstanz in der 3. Person durchs Leben.
Eine solche Nicht-Figur kann mitfühlender oder weniger mitfühlend sein als ihr Verfasser, politischer oder unpolitischer, aufmerksamer oder weniger aufmerksam, moralischer oder unmoralischer. In jedem Fall erfinden Prosaautoren auch für ihre Erzählinstanz eine linguistische Form, so, wie sie jeder ihrer Figuren eine Stimme geben, denn sie wissen, dass die Leser diese Erzählinstanz als wesens- und dialogfreie erzählerische Konvention akzeptieren, so wie sich auch das Publikum in Film und Fernsehen bzw. im Theater bereitwillig den Erzählerfiguren am Bühnenrand oder aus dem Off überlässt.
Die Sprache, die eine solche Instanz verwendet, kann zutiefst ausdrucksvoll sein, und es ist durchaus möglich, dass die Leser ihr im Geiste lauschen, als wäre sie eine konkrete Stimme. Das ist sie aber nicht. Nur Figuren haben echte Stimmen. Was wir als »Stimme« dieser Erzählinstanz bezeichnen, ist schlicht und einfach der literarische Stil eines Autors oder einer Autorin. Deswegen empfinden Leser auch weder Empathie für diese Stimme noch Neugier auf das Schicksal des dahinterstehenden Bewusstseins.
Durch Konventionen, die noch älter sind als Homer, wissen die Leser, dass ein Autor oder eine Autorin diese Nicht-Figur einzig zu dem Zweck erschaffen hat, die Handlung in eine Sprache zu kleiden, der die Leserschaft folgen kann. Würde die Instanz hingegen plötzlich als »Ich« von sich sprechen, dann würde aus der Nicht-Figur eine echte Figur und aus der Handlung eine Ich-Erzählung.
Das Wissensspektrum einer Erzählinstanz reicht von allwissend bis hin zu eingeschränkt, ihr Urteilsvermögen von moralisch neutral bis hin zu kritisch; sie kann im Geist ihrer Leser ganz offensichtlich oder versteckter präsent sein, ihre Glaubwürdigkeit bewegt sich zwischen ehrlich und trügerisch (Letzteres allerdings nur sehr selten). Im Spiel mit diesen Dimensionen können Prosaautoren ihre Erzählinstanz mit verschiedenen Abstufungen der Objektivität bzw. Subjektivität ausstatten, von ironisch-distanziert bis zu tiefgreifend beteiligt.
Читать дальше