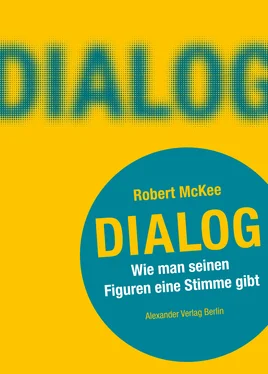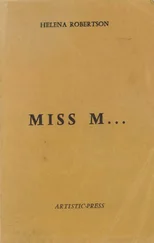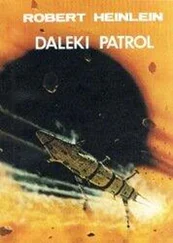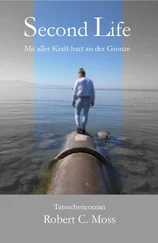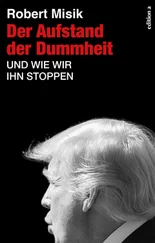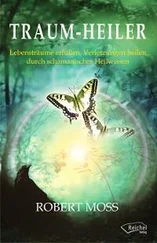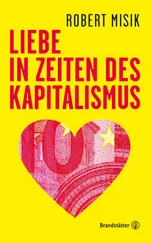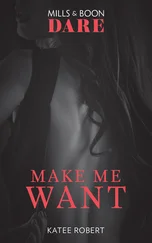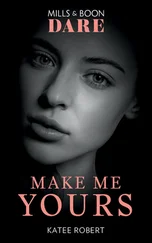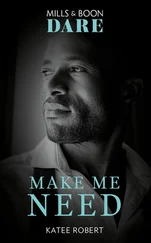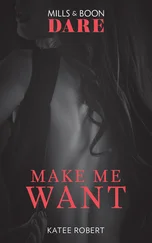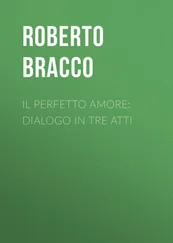TEIL I
1
AUSFÜHRLICHE DEFINITION DES DIALOGBEGRIFFS
Dialog: Jedes Wort, das eine Figur zu einer anderen sagt .
Traditionell wird ein Dialog als Gespräch zwischen Figuren definiert. Ich glaube allerdings, dass man für eine umfassende, tiefgehende Analyse zum Thema Dialog erst einmal einen Schritt zurück machen und mit dem weitestmöglichen Blick auf das Erzählen an sich beginnen muss. Aus dieser Perspektive fällt mir als Erstes auf, dass sich Figurenrede auf drei klar unterscheidbaren Schienen bewegt: mit anderen reden, mit sich selbst reden und mit den Lesern/Zuschauern reden.
Diese drei Arten des Redens fasse ich unter dem Begriff »Dialog« zusammen, und zwar aus zwei Gründen: Erstens, weil Autoren ihre Rollen immer mit einer einzigartigen, figurenspezifischen Stimme personalisieren müssen, die sich im Text äußert, unabhängig davon, wann, wo und mit wem die betreffende Figur gerade spricht. Und zweitens, weil alles Reden, ob nun stumm oder verbal, ob im Kopf gedacht oder in die Welt hinaus gerufen, immer die nach außen gerichtete Umsetzung einer inneren Aktion ist. Alles Sprechen reagiert auf ein Bedürfnis, verfolgt einen Zweck und führt eine Aktion durch. So scheinbar vage und leichthin eine Äußerung auch sein mag, keine Figur spricht jemals grundlos, ohne ein Anliegen, mit jemanden, nicht einmal mit sich selbst. Darum müssen Schreibende jede Zeile ihrer Figurenrede mit einem Wunsch, einer Absicht und einer Aktion unterlegen. Aus dieser Aktion wird dann die sprachliche Taktik, die wir »Dialog« nennen.
Sehen wir uns die drei Dialog-Schienen einmal genauer an.
1. Mit anderen reden: Der korrekte Ausdruck für ein Gespräch mit zwei Beteiligten lautet Zwiegespräch(oder Duologin meiner Terminologie). Drei Figuren im Gespräch miteinander bilden einen Trialog. Das Gespräch einer zwölfköpfigen Familie, die sich an Thanksgiving zusammenfindet, könnte man als Multilog bezeichnen, wenn es diesen Begriff gäbe.
2. Mit sich selbst reden: Drehbuchautoren verlangen nur selten Selbstgespräche von ihren Figuren, Bühnenautoren dafür umso häufiger. Was Prosaautoren angeht, so ist das innere Gespräch Gehalt und Grundlage ihrer Kunst. Prosa hat die Macht, in den Kopf der Figuren einzudringen und ihren inneren Konflikt auf die Gedankenlandschaft zu projizieren. Jedes Mal, wenn Autoren ihre Story aus der Ich- oder Du-Perspektive erzählen, gehört diese Stimme einer Figur. Prosa ist daher oft erfüllt von reflexiven Selbstgesprächen, die man als Leser sozusagen mithört.
3. Mit Lesern/Zuschauern reden. Im Theater erlauben die Konventionen des Monologs und des Beiseitesprechens den Figuren, sich direkt an das Publikum zu wenden und vertraulich mit ihm zu reden. In Film und Fernsehen platziert die Konvention diese Figur meist außerhalb des Bildes und lässt sie als Voiceover sprechen, hin und wieder wird die Figur aber auch veranlasst, sich direkt in die Kamera zu wenden. In der Prosa ist das der Kern der Ich-Erzählung: Eine Figur erzählt den Lesern ihre Geschichte, ihre Story.
Etymologisch geht das Wort »Dialog« auf zwei griechische Wortteile zurück: diá- in der Bedeutung »durch« und légein , das sich auf das »Sprechen« bezieht. Würde man beides direkt übersetzen, ergäbe sich das zusammengesetzte Substantiv »Durch-Sprechen« – eine Aktion, die durch Worte – im Gegensatz zu Taten – erfolgt. Jeder Satz, den eine Figur spricht, ob nun laut zu anderen oder leise zu sich, ist, in den Worten von J. L. Austin, ein Sprechakt: Worte, die eine Aktion durchführen. 4
Etwas sagen heißt also etwas tun, und deshalb habe ich meine Neudefinition des Dialogbegriffs dahingehend erweitert, dass er jedes einzelne Wort, das eine Figur zu sich selbst, zu anderen oder zu den Lesern/Zuschauern sagt, als Aktion benennt, die ein Bedürfnis oder einen Wunsch befriedigt. In allen drei Fällen agiert die Figur verbal (im Gegensatz zu physisch), sobald sie spricht, und jede dieser Aktionen durch Sprechen bringt die Szene, in der sie auftritt, von einem Beat zum nächsten, während sie gleichzeitig die Figur dynamisch vorantreibt, sie der Erfüllung ihres Herzenswunsches näher bringt (positiv) oder weiter davon wegführt (negativ). Dialog als Aktion, das ist auch das Grundprinzip dieses Buches.
Dialoge können auf zweierlei Arten agieren: dramatisch oder narrativ.
Dramatischmeint hier szenisch gestaltet. Ob sein Grundton nun komisch oder tragisch ist, ein dramatischer Dialog spielt die Äußerungen zwischen zwei Figuren hin und her, die einen Konflikt austragen. Jede Äußerung beinhaltet eine Aktion mit einer konkreten Intention und ruft irgendwo in der Szene eine Reaktion hervor.
Das gilt auch für Szenen mit nur einer Figur. Wenn jemand sagt: »Ich bin sauer auf mich«, wer ist dann sauer auf wen? So, wie man sich im Spiegel sieht, kann man sich auch in der eigenen Vorstellung sehen. Um mit sich selbst streiten zu können, erschafft der Geist ein zweites Ich und redet mit ihm, als handelte es sich um jemand anderen. Der innere Dialog einer Figur wird zur dynamisch-dramatischen Szene zwischen zwei zerstrittenen Ichs ein und derselben Person, von denen eines den Streit vielleicht gewinnen wird, vielleicht aber auch nicht. Streng genommen ist also jeder Monolog in Wahrheit ein Dialog. Sobald eine Figur spricht, spricht sie immer mit jemand anderem, und sei es nur eine andere Seite ihrer selbst.
Narrativbedeutet außerhalb der Szene gesprochen. In solchen Fällen verschwindet die sogenannte vierte Wand des Realismus, und die Figur tritt aus dem dramatischen Ablauf der Story heraus. Auch hier sind narrative Reden streng genommen keine Monologe, sondern Dialoge, in denen die Figur die verbale Aktion vornimmt, sich direkt an die Leser, Zuschauer oder an sich selbst zu wenden.
Was den zugrundeliegenden Wunsch betrifft, so möchte ein Ich-Erzähler in einem Prosatext oder eine Figur, die von der Bühne oder Leinwand herunter erzählt, ihre Leser/Zuschauer vielleicht einfach nur auf den aktuellen Stand der Ereignisse bringen und ihre Neugier auf Künftiges wecken. Womöglich nutzt sie den narrativen Dialog also nur dafür, dieses schlichte Vorhaben umzusetzen.
In einer komplexeren Situation könnte die Figur ihre Worte beispielsweise nutzen, um die Leser/Zuschauer dazu zu bewegen, ihre früheren Missetaten zu verzeihen, und sie gleichzeitig dahingehend zu beeinflussen, dass sie die Feinde der Figur ebenfalls aus ihrem voreingenommenen Blickwinkel, ihrem Point of View (POV), sehen. Den möglichen Wünschen, die eine Figur von Story zu Story zur Aktion anregen, und der Taktik, die sie jeweils einsetzt, wenn sie zu den Lesern/Zuschauern spricht, scheinen keine Grenzen gesetzt.
Das Gleiche gilt für eine Figur, die sich nach innen wendet, um ein Gespräch mit sich selbst zu führen. Damit kann sie jeden beliebigen Zweck verfolgen: eine Erinnerung aus reiner Freude noch einmal durchleben, sich den Kopf zerbrechen, ob sie auf die Zuneigung eines geliebten Menschen wirklich bauen kann, die eigene Hoffnung schüren, indem sie sich ein künftiges Leben ausmalt etc. – während ihre Gedanken Vergangenheit, Gegenwart und jede mögliche Zukunft, erdacht oder real, durchstreifen.
Um zu zeigen, wie derselbe Inhalt in drei verschiedenen Dialogformen ausgedrückt werden kann, möchte ich mit einer Passage aus dem Roman Doktor Glas arbeiten, der 1905 von dem schwedischen Schriftsteller Hjalmar Söderberg verfasst wurde.
Das Buch hat die Form eines Tagebuchs, das vom Titelhelden selbst geführt wird. Ein reales Tagebuch zeichnet die heimlichen Gespräche auf, die Tagebuchschreibende mit sich selbst führen; folglich muss auch ein fiktives Tagebuch so geschrieben sein, dass die Leser das Gefühl bekommen, sie könnten den heimlichen inneren Dialog irgendwie mithören.
Читать дальше