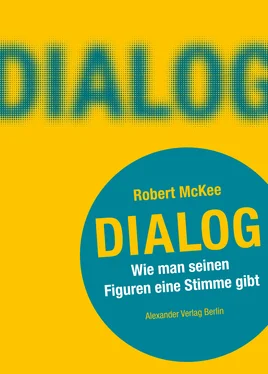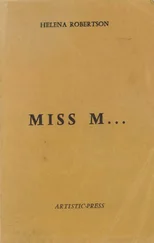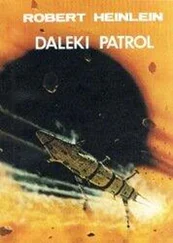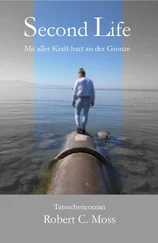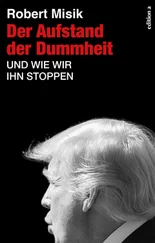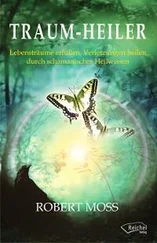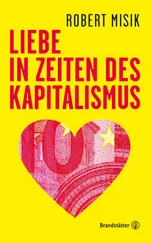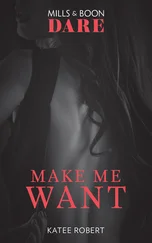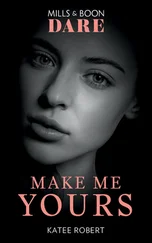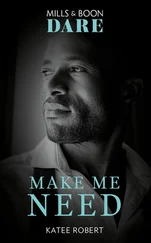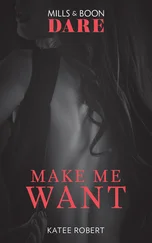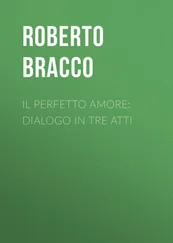1 ...6 7 8 10 11 12 ...16 Viel zu oft befriedigen derartige Vorträge nur das äußerliche Bedürfnis von Autoren, den gebannten Lesern/Zuschauern ihre Meinung einzuflüstern, und nicht das der Figur immanente Bedürfnis nach Aktion. Schlimmer noch: Sagen beseitigt jeden Subtext. Während die Figur ihre Wünsche verfolgt und dabei mit Gegenwind zu kämpfen hat, laden ihre verbalen Reaktionen und Taktiken Leser und Zuschauer dazu ein, ihre unausgesprochenen Gedanken und Gefühle zu ergründen. Wenn Autoren ihren Figuren allerdings zwanghaft unmotivierte Expositionen in den Mund legen, verstellen diese undurchdringlichen Sätze dem Story-Rezipienten jeden Zugang zum Innenleben des oder der Sprechenden. Und je mehr die Figur zum Sprachrohr der Ideen ihres Autors verflacht, desto mehr schwindet das Interesse.
Schließlich bringt Zeigen auch die innere Beteiligung und das Tempo voran, während Sagen die Neugier dämpft und das Tempo verlangsamt. Zeigen behandelt Leser und Zuschauer wie Erwachsene, es bittet sie in die Story hinein, ermuntert sie, ihre Gefühlswelt der Vision des Autors oder der Autorin zu öffnen, ins Herz der Dinge zu blicken und dann weiter auf künftige Ereignisse. Sagen behandelt sie wie Kinder, die von einem Elternteil auf den Schoß genommen werden und das Offensichtliche erklärt bekommen.
Die folgende Äußerung beispielsweise ist reines Sagen. Während Harry und Charlie die Tür zu ihrer gemeinsamen Reinigung aufschließen, sagt Charlie:
Ach, Harry, wie lange kennen wir uns jetzt schon? Zwanzig Jahre bestimmt, vielleicht sogar noch länger, seit wir zusammen zur Schule gegangen sind. Eine ganz schön lange Zeit, was, mein alter Freund? Und wie geht es dir heute, an diesem schönen Morgen?
Dieser Dialogbeitrag hat keinen anderen Zweck, als den Lesern/Zuschauern zu vermitteln, dass Charlie und Harry seit über zwanzig Jahren befreundet und zusammen zur Schule gegangen sind, und dass der Tag gerade angefangen hat.
Die folgende Äußerung dagegen zeigt:
Charlie schließt die Tür zur Reinigung auf, Harry lehnt unrasiert und im T-Shirt am Türstock, zieht an einem Joint und kichert haltlos. Charlie mustert ihn kopfschüttelnd .
CHARLIE: Verdammt, Harry, wann wirst du endlich erwachsen?
Schau dich doch nur mal an, mit deinen bescheuerten Batik-T-Shirts. Du bist immer noch derselbe unreife Quatschkopf wie vor zwanzig Jahren in der Schule und hast dich kein bisschen verändert. Reiß dich endlich am Riemen, Harry. Riechst du die Scheiße nicht, in der du steckst?
Die Fantasie der Leser bzw. die Blicke der Zuschauer wandern zu Harry, um seine Reaktion auf diese Beleidigung nicht zu verpassen, und dabei haben sie praktisch unbemerkt die Worte »zwanzig Jahre« und »Schule« mitgenommen.
Alle unerlässlichen fiktiven Fakten müssen irgendwann ihren Weg in die Story finden, getimt auf den wirkungsvollsten Moment und so aufgeladen, dass sie eine entscheidende Einsicht vermitteln. Aber diese Details und die von ihnen hervorgerufenen Wahrnehmungen müssen ins Bewusstsein der Leser/Zuschauer gelangen, ohne sie vom Fluss der Ereignisse abzulenken. Ein Autor muss die Aufmerksamkeit seiner Leser/ Zuschauer also in die eine Richtung lenken und dabei aus einer ganz anderen Richtung Fakten einschmuggeln.
Dieser Taschenspielertrick erfordert eine der beiden folgenden Techniken, vielleicht auch beide: Narrativer Driveund Exposition als Munition. Ersterer Kunstgriff setzt bei der intellektuellen Neugier an, letzterer bei der emotionalen Empathie.
Der narrative Driveist ein Nebeneffekt der geistigen Auseinandersetzung mit der Story. Veränderungen und Offenbarungen führen die Story-Rezipienten zu der Frage: »Was wird wohl als Nächstes passieren? Und was danach? Wie wird das alles enden?« Während die einzelnen Expositionshäppchen quasi im Hintergrund aus dem Dialog ins Bewusstsein der Leser und Zuschauer gelangen, greift deren Neugier schon mit beiden Händen in die Zukunft, um sich mit den erhaschten Schnipseln den Weg durch die Erzählung zu bahnen. Das, was sie wissen müssen, erfahren sie in dem Moment, in dem es nötig ist, sie nehmen aber nie bewusst wahr, dass man ihnen etwas mitteilt, weil alles, was sie erfahren, ihren Blick nach vorne ausrichtet.
Überzeugen wir uns von der Kraft der Exposition beim Auslösen eines narrativen Drives durch einen Roman, der selbst nach einem Expositionsbestandteil heißt: Catch 22 [in der deutschen Übersetzung als »X-Haken« wiedergegeben, Anm. d. Ü.]. Der Autor Joseph Heller hat diesen Begriff erfunden, um die Sorte bürokratischer Fallen zu beschreiben, die ihre Opfer in einen logischen Teufelskreis sperren.
Die Handlung spielt auf einem Stützpunkt der Air Force im Mittelmeer, während des Zweiten Weltkriegs. Im fünften Kapitel fragt Captain John Yossariàn, der Protagonist des Romans, den Truppenarzt Doc Daneeka nach einem Kampfpiloten namens Orr:
»Ist Orr verrückt?«
»Klar ist er verrückt«, sagte Doc Daneeka.
»Kannst du ihn fluguntauglich schreiben?«
»Klar kann ich das. Er muss aber erst darum bitten. So verlangt es die Vorschrift.«
»Warum bittet er dich dann nicht darum?«
»Weil er verrückt ist«, sagte Doc Daneeka. »Er muss einfach verrückt sein, sonst würde er nicht immer wieder Einsätze fliegen, obgleich er oft genug knapp mit dem Leben davongekommen ist. Selbstverständlich kann ich Orr fluguntauglich schreiben. Er muss mich aber erst darum bitten.«
»Mehr braucht er nicht zu tun, um fluguntauglich geschrieben zu werden?«
»Nein, mehr nicht. Er braucht mich nur zu bitten.«
»Und dann kannst du ihn fluguntauglich schreiben?«, fragte Yossariàn.
»Nein. Dann kann ich es nicht mehr.«
»Heißt das, dass die Sache einen Haken hat?«
»Klar hat sie einen Haken«, erwiderte Doc Daneeka. »Den X-Haken. Wer den Wunsch hat, sich vorm Fronteinsatz zu drücken, kann nicht verrückt sein.«
Es war nur ein Haken bei der Sache, und das war der X-Haken. X besagte, dass die Sorge um die eigene Sicherheit angesichts realer, unmittelbarer Gefahr als Beweis für fehlerloses Funktionieren des Gehirns zu werten sei. Orr war verrückt und konnte fluguntauglich geschrieben werden. Er brauchte nichts weiter zu tun, als ein entsprechendes Gesuch zu machen, tat er dies aber, so galt er nicht länger mehr als verrückt und würde weitere Einsätze fliegen müssen. Orr wäre verrückt, wenn er noch weitere Einsätze flöge, und bei Verstand, wenn er das ablehnte, doch wenn er bei Verstand war, musste er eben fliegen. Flog er diese Einsätze, so war er verrückt und brauchte nicht zu fliegen; weigerte er sich aber zu fliegen, so musste er für geistig gesund gelten und war daher verpflichtet zu fliegen. Die unübertreffliche Schlichtheit dieser Klausel beeindruckte Yossariàn zutiefst, und er stieß einen bewundernden Pfiff aus.
»Das ist schon so ein Haken, dieser X-Haken«, bemerkte er. 10
Beachten Sie, wie Heller einen Abschnitt aus indirektem Dialog in diese dramatische Dialogszene einbaut. Die Paraphrase der Romanpassage teilt uns mit, was Daneeka Yossariàn erzählt hat und wie Yossariàn als Reaktion darauf einen Pfiff ausstößt. Obwohl der Abschnitt in der 3. Person gehalten ist, was ihm einen Hauch von auktorialem Kommentar verleiht, handelt es sich hier um ein Beispiel für Zeigen statt Sagen, und zwar aus folgenden Gründen: Erstens findet es innerhalb der Szene statt. Und zweitens fördert es die dynamische Aktion der Szene: Daneeka will von Yossariàn nicht mehr mit Ausreden behelligt werden, damit dieser um seine Kampfeinsätze kommt, und Yossariàn wird auf einmal klar, wie sinnlos es ist, Wahnsinn vorzutäuschen. Daneekas Offenbarung wird zum Wendepunkt, der den Plot um Yossariàn ins Negative dreht.
Im Hinblick auf den narrativen Drive springen die Lesererwartungen in dem Moment weit voraus, als die unausweichliche Logik des X-Hakens, des Catch 22 , klar wird. Wie, fragt man sich, wird sich Yossariàn oder eine der anderen Figuren dem eisernen Griff dieser absurden militärischen Regelung entwinden? Werden sie das überhaupt schaffen? Die ständige Suche der Leser/Zuschauer nach Antworten auf die von den expositorischen Offenbarungen aufgeworfenen Fragen befeuert den narrativen Drive.
Читать дальше