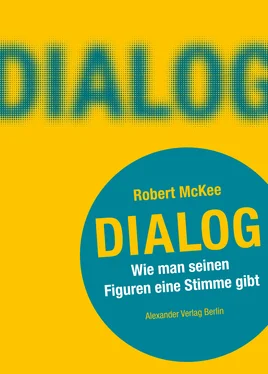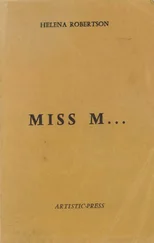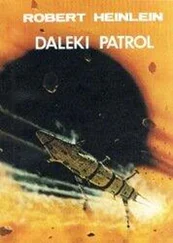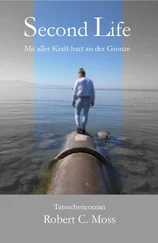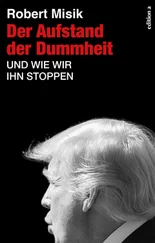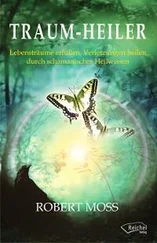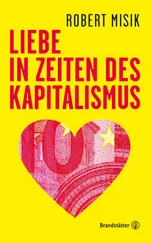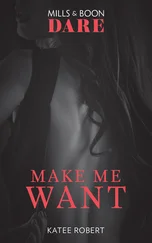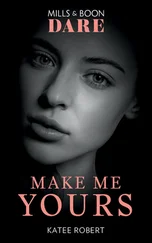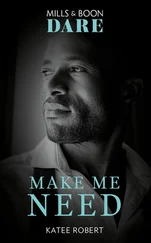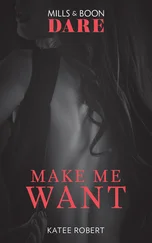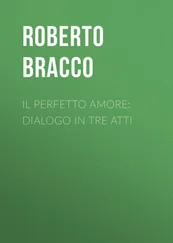1 ...7 8 9 11 12 13 ...16 Die zweite Technik zur unbemerkten Weitergabe expositorischer Informationen stützt sich auf die emotionale Beteiligung der Story-Rezipienten. Deren Empathie beginnt mit folgender Überlegung: »Diese Figur ist ein Mensch wie ich. Und darum möchte ich, dass die Figur alles bekommt, was sie will, denn wäre ich diese Figur, würde ich das auch wollen.« Sobald Story-Rezipienten das Menschliche erkennen, das sie mit den Figuren gemeinsam haben, identifizieren sie sich nicht nur mit ihnen, sondern übertragen auch ihre eigenen, realen Wünsche auf die fiktiven Wünsche der Figuren.
Ist die innere Beteiligung durch diese empathische Verbindung erst einmal etabliert, funktioniert die Technik der Exposition als Munition folgendermaßen: Ihr Figurenpersonal verfügt über genau das Wissen über die Vergangenheit, die Gegenwart, sich selbst und die anderen, das Ihre Leser/Zuschauer benötigen, um den Ereignissen folgen zu können. Erlauben Sie also Ihren Figuren in wichtigen Schlüsselmomenten, ihr Wissen im Kampf um das, was sie haben wollen, als Munition einzusetzen. Den emotional beteiligten Lesern/Zuschauern verschaffen solche Offenbarungen echte Entdeckerfreuden, während die Fakten selbst rasch im Hintergrund ihres Bewusstseins verschwinden.
Betrachten wir als Beispiel die ursprüngliche Star-Wars -Trilogie. Alle drei Filme haben ihren Dreh- und Angelpunkt in derselben Tatsache: Darth Vader ist Luke Skywalkers Vater. Das erzählerische Problem für George Lucas bestand nun darin, wann und wie er diesen Teil der Exposition vermittelt. Er hätte ihn ja auch jederzeit im ersten Film offenbaren können, indem er beispielsweise C-3PO R2-D2 zuflüstern lässt: »Erzähl Luke bloß nichts davon, sonst regt er sich nur fürchterlich auf, aber Darth ist sein Daddy.« So wäre die Information auch ans Publikum gelangt, allerdings mit minimaler, fast schon lachhafter Wirkung. Stattdessen hat Lucas die Exposition als Munition eingesetzt und die berühmteste Szene der ganzen Trilogie daraus gemacht.
Auf dem Höhepunkt der Story des zweiten Films, Das Imperium schlägt zurück , trifft Luke Skywalker die heldenhafte Entscheidung, gegen Darth Vader zu kämpfen. Während sich die Lichtschwerter kreuzen, gewinnt der Urschurke die Oberhand, und der Außenseiter droht zu unterliegen. Durch die Empathie für Luke und die Sorge, wie es ausgehen wird, nimmt der Moment das Publikum ganz gefangen.
In der konventionellen Action-Dramaturgie findet der Held irgendwann eine unerwartete Möglichkeit, das Blatt gegen den Bösewicht zu wenden. Stattdessen bringt George Lucas mitten im Duell eine Motivation in Anschlag, die er bisher im Subtext verborgen hat. Darth Vader will den entfremdeten Sohn zu sich auf die berüchtigte dunkle Seite der Macht ziehen, steht nun aber vor einem Dilemma aus zwei Übeln: Er muss sein eigenes Kind töten oder sich von ihm töten lassen. Um diesem Dilemma zu entkommen, nutzt Vader einen der berühmtesten Expositionsbestandteile als Munition, um seinen Sohn zu entwaffnen: »Ich bin dein Vater.« Doch anstatt seinen Sohn mit dieser Offenbarung zu retten, treibt er Luke damit in einen Selbstmordversuch.
Die in den ersten beiden Filmen verborgene Wahrheit wird zum plötzlichen Schockmoment für das Publikum und treibt es zum Mitgefühl mit Luke und in die Angst um seine Zukunft. Die biographische Tatsache, hier als Munition verwendet, vermittelt eine gewaltige rückblickende Einsicht in die Tiefe der Charaktere und die vorausgegangenen Ereignisse, es überschwemmt das Publikum mit einer Gefühlswelle und bereitet die letzte Folge der Trilogie vor.
In praktisch jeder erzählten Story, ob nun Komödie oder Tragödie, sind die wichtigsten expositorischen Fakten immer Geheimnisse, dunkle Wahrheiten, die die Figuren vor der Welt und manchmal sogar vor sich selbst verbergen.
Und wann kommen Geheimnisse ans Licht? Wenn jemand vor einem Dilemma steht, bei dem es gilt, das kleinere Übel zu wählen: »Wenn ich mein Geheimnis offenbare, riskiere ich damit, den Respekt meiner Lieben zu verlieren« gegen »Aber wenn ich mein Geheimnis nicht offenbare, passiert etwas noch viel Schlimmeres«. Der Druck dieses Dilemmas bringt die Geheimnisse in Bewegung, und während sie gelüftet werden, entwickeln sie eine Wucht, aus der kraftvolle Wendepunkte entstehen. Aber woher kommen die Geheimnisse?
Die Backstory: Frühere Ereignisse, die künftige vorantreiben
Der Begriff » Backstory« wird häufig missverstanden und fälschlich in der Bedeutung von »Lebensgeschichte« verwendet. Die Biographie einer Figur besteht aus dem lebenslangen Zusammenspiel von Genen und Erfahrungen. Die Backstory ist eine Teilmenge dieser Gesamtheit – ein meist geheimes Vergangenheitsexzerpt aus Ereignissen, die von Autoren in Schlüsselmomenten offengelegt werden, um ihre Story zum Höhepunkt zu führen. Da Offenbarungen aus der Backstory oft einschneidendere Auswirkungen haben als eindeutige Aktionen, bleiben sie für die großen Wendepunkte reserviert. Nachstehend finden Sie ein berühmtes Beispiel dieser Technik.
Wer hat Angst vor Virginia Woolf?
In diesem 1962 verfassten Stück von Edward Albee ertragen George und Martha, ein Paar mittleren Alters, ihre konfliktreiche Ehe. Zwei Jahrzehnte lang haben sie praktisch ständig über jeden winzigen Aspekt der Erziehung ihres Sohnes Jim gestritten. Nach einer anstrengenden, exzessiven Partynacht voller Alkohol, Beschimpfungen und Ehebruch, gekrönt von einem heftigen Streit über ihren Sohn vor den Gästen, wendet sich George an Martha und sagt:
GEORGE: Wir haben noch eine kleine Überraschung für dich, Martha.
Es handelt sich um unsern Augapfel … um unsern Jimmy.
MARTHA: Schluss, George.
GEORGE: NEIN, MARTHA! (…) Mein Schatz, ich fürchte, ich habe eine schlimme Nachricht für dich … für uns natürlich … eine sehr traurige Nachricht.
MARTHA (argwöhnisch, ängstlich) : Was? Was für eine Nachricht?
GEORGE (ach so geduldig) : Ja, Martha, als du draußen warst (…), da klingelten plötzlich die Türglocken (…). Sie läuteten … Und – es fällt mir schwer, es dir zu sagen, Martha …
MARTHA (mit einer merkwürdigen, heiseren Stimme) : Sag es mir.
GEORGE: Es war … es war ein Telegrafenbote … ein kleiner Junge … ungefähr siebzig …
MARTHA (interessiert) : Der verrückte Willy?
GEORGE: Ja, Martha, der verrückte Willy … Und er brachte ein Telegramm … an uns beide adressiert … und ich muss dir sagen, was drinstand.
MARTHA (abwesend) : Warum haben sie es nicht telefonisch durchgegeben, das tun sie sonst doch immer? Warum haben sie es hergebracht? Warum haben sie es nicht telefonisch durchgegeben?
GEORGE: Es gibt Telegramme, die zugestellt werden müssen, Martha. Es gibt Telegramme, die man nicht telefonisch durchgibt.
MARTHA (steht auf) : Was heißt das?
GEORGE: Martha … ich weiß nicht, wie ich es sagen soll … (…) (seufzt tief) Martha, ich fürchte, unser Junge kommt zu seinem Geburtstag nicht nach Hause.
MARTHA: Natürlich kommt er.
GEORGE: Nein, Martha.
MARTHA: Doch, er kommt. Wenn ich sage, er kommt, dann kommt er!
GEORGE: Nein … er … kann nicht.
MARTHA: Doch, er kommt!
GEORGE: Martha … (Lange Pause.) … unser Sohn … ist tot. (Stille.) Er ist … verunglückt … am späten Nachmittag … (Stille. Ein unmerkliches Kichern.) … auf einer Landstraße … seinen Lernfahrausweis in der Tasche … er wollte einem Stachelschwein …
MARTHA (starr vor Entsetzen und rasend vor Wut) : DAS … DARFST … DU NICHT!
GEORGE: … ausweichen.
MARTHA: DAS DARFST DU NICHT!
Читать дальше