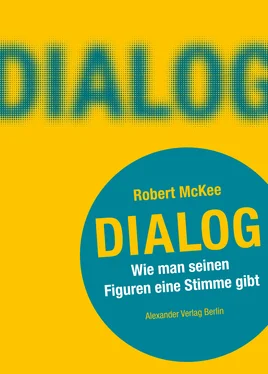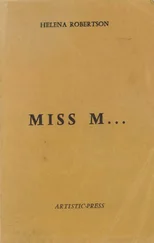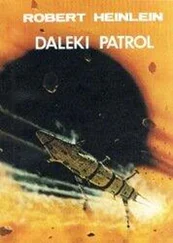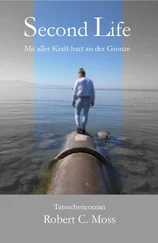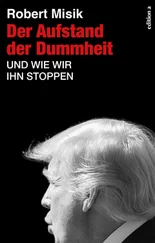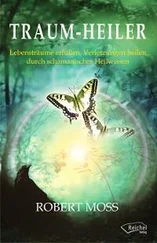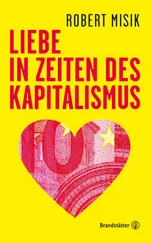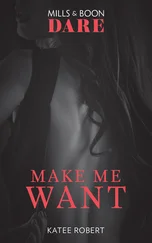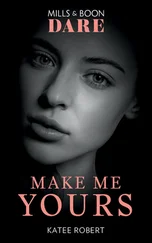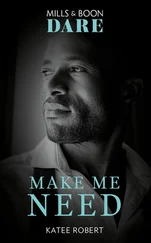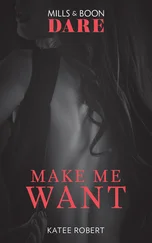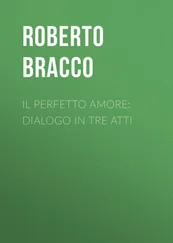Die zweite Funktion von Dialogen besteht darin, jeder handelnden Figur eine unverwechselbare Charakterisierung zu schaffen und diese dann zum Ausdruck zu bringen.
Die menschliche Natur lässt sich sinnvollerweise in zwei vorherrschende Aspekte unterteilen: Schein (das, was eine Person zu sein vorgibt) und Sein (das, was eine Person wirklich ist). Autoren gestalten ihre Figuren also unter Verwendung zweier zusammenhängender Komponenten: wahrer Charakter und Charakterisierung.
Der wahre Charakter– die Bezeichnung sagt es schon – meint das innerste psychologisch-moralische Wesen einer Figur, eine Wahrheit, die sich nur offenbart, wenn das Leben die Figur unter Druck setzt, in die Enge treibt und sie dazu zwingt, Entscheidungen zu treffen, aktiv zu werden. Allem Erzählen, ob fiktiv oder nicht, liegt das Prinzip der Entscheidung zugrunde: dass sich der wahre Charakter einer Figur nämlich nur durch risikoreiche Entscheidungen beim Verfolgen seiner Wünsche offenbart.
Die Charakterisierungbezeichnet die gesamte Erscheinung – den Schein – einer Figur, die Summe all ihrer oberflächlichen Eigenschaften und Verhaltensweisen. Sie erfüllt drei Funktionen: Interesse wecken, Überzeugen und Individualität schaffen.
1. Interesse wecken:Leser und Zuschauer wissen, dass die Erscheinung einer Figur nicht ihrem wahren Sein entspricht, dass ihre Charakterisierung Fassade ist, eine Persönlichkeitsmaske zwischen der Welt und dem wahren Charakter dahinter. Treffen diese Leser/Zuschauer nun auf eine einzigartige Persönlichkeit, dann hören sie sich an, was die Figur sagt, und fragen sich naturgemäß: »So scheint sie zu sein, aber wie ist sie wirklich? Ist sie tatsächlich ehrlich, oder lügt sie? Ist sie liebevoll oder grausam? Klug oder töricht? Gelassen oder unbedacht? Willensstark oder schwach? Gut oder böse? Was ist der Wesenskern hinter ihrer interessanten Charakterisierung? Was ist ihr wahrer Charakter?«
Sobald die Story sich das Interesse der Leser/Zuschauer gesichert hat, wird sie zu einer Abfolge überraschender Offenbarungen, die Antworten auf diese Fragen geben.
2. Überzeugen:Eine gut erdachte, gut entwickelte Charakterisierung versammelt (geistige und körperliche) Fähigkeiten und (emotionale und verbale) Verhaltensweisen, die Leser/Zuschauer dazu anhält, so an eine fiktive Figur zu glauben, als wäre sie echt. Wie der englische Dichter Samuel Taylor Coleridge schon vor zweihundert Jahren festgehalten hat, wissen die Leser/Zuschauer natürlich, dass Storys und Figuren nicht real sind. Aber sie wissen auch, dass sie, um sich auf die Erzählung richtig einlassen zu können, vorübergehend daran glauben oder besser gesagt, ihren Unglauben willentlich außer Kraft setzen und die Aktionen und Reaktionen der Figuren akzeptieren müssen, ohne zu zweifeln oder dagegenzuhalten.
Wenn Ihre Leser/Zuschauer sich denken: »Ich glaube ihr kein Wort«, weil sie spüren, dass die Figur lügt, könnte das eine Offenbarung ihres wahren Charakters sein. Wenn sie dasselbe aber denken, weil sie einfach nicht an Ihre Figur glauben, dann ist es Zeit für eine neue Fassung.
3. Individualität schaffen:Eine gut erdachte, gut recherchierte Charakterisierung erzeugt eine einzigartige Kombination aus genetischen Anlagen, Erziehung, Körper, Geist, Gefühl, Bildung, Erfahrung, Haltung, Werten, Geschmack und jeder denkbaren Nuance kultureller Einflüsse, denen die Figur ihre Individualität verdankt. So, wie sie durch den Tag geht, wie sie ihre berufliche Karriere verfolgt, ihre Beziehungen, ihre Sexualität, ihre Gesundheit, ihr Glück und dergleichen, fasst sie ihre Verhaltensweisen zu einer einzigartigen Persönlichkeit zusammen.
Und die wichtigste Charaktereigenschaft überhaupt ist: Sprechen. Sie spricht ganz anders als irgendjemand sonst, dem wir bisher begegnet sind. Ihr Sprachstil setzt sie nicht nur vom übrigen Figurenpersonal ab, sondern, wenn es sich um meisterhaftes Schreiben handelt, auch von allen anderen fiktiven Figuren. Ein noch recht aktuelles Beispiel ist Jeanette »Jasmine« Francis (Cate Blanchett) aus Woody Allens Blue Jasmine . (Auf die Charakterisierung durch Dialog wird in den Kapiteln 10und 11noch genauer eingegangen.)
Die dritte grundlegende Funktion von Dialogen besteht darin, die Figuren mit der Möglichkeit zur Aktion auszustatten. Storys können drei verschiedene Arten der Aktion enthalten: geistige Aktion, körperliche Aktion und verbale Aktion.
Geistige Aktion:Gedanken setzen sich aus Wörtern und Bildern zusammen, und doch wird ein Gedanke erst zu einer geistigen Aktion, wenn er in einer Figur eine Veränderung auslöst – eine Veränderung in der Haltung, im Glauben, in der Erwartung, im Begreifen etc. Geistige Aktionen können sich in äußeres Verhalten umsetzen, müssen das aber keineswegs, und selbst wenn die geistige Aktion geheim bleibt und sich nicht äußert, ist die Figur, die sie unternommen hat, anschließend nicht mehr dieselbe. Figurenveränderungen durch geistige Aktionen befeuern vor allem das moderne Erzählen.
Körperliche Aktion:Körperliche Aktion findet zwei grundlegende Ausdrucksformen: Gesten und Tätigkeiten.
Mit Gesten meine ich die Körpersprache in all ihren Variationen: Gesichtsausdrücke, Handbewegungen, Körperhaltung, Berührungen, Proxemik, Kinesik, Stimmfarbe etc. Solche Verhaltensweisen können sprachliche Äußerungen entweder verändern oder sie sogar ersetzen, weil sie Gefühle besser ausdrücken können als Worte. 15
Als Tätigkeiten bezeichne ich alle Aktivitäten, bei denen etwas getan wird: Arbeiten, Spielen, Reisen, Schlafen, Sex, Streiten, Tagträumen, Lesen, den Sonnenuntergang bewundern etc. – lauter Taten, die nicht unbedingt der Sprache bedürfen.
Verbale Aktion:Um es mit den Worten der Romanautorin Elizabeth Bowen zu sagen: »Dialoge sind das, was die Figuren einander antun.« 16
Auf der Ebene äußerer Verhaltensweisen verschmilzt der Dialogstil einer Figur mit ihren übrigen Eigenschaften zu ihrer oberflächlichen Charakterisierung, doch auf der inneren Ebene des wahren Charakters offenbaren die Aktionen, die sie in die Welt hinausträgt, ihre Menschlichkeit oder den Mangel daran. Mehr noch, je höher der Druck in der jeweiligen Szene ist (je mehr die Figur in dem Moment also zu gewinnen oder zu verlieren hat), desto klarer sagen uns ihre Aktionen, wer sie wirklich ist.
Die Äußerungen einer Figur bewegen ihre Leser/Zuschauer allerdings nur, wenn die Aktionen, die sie jenseits des Textes durchführt, für diese konkrete Figur in diesem konkreten Moment wahrhaftig erscheinen. Stellen Sie sich also vor jedem Satz, den Sie schreiben, folgende Frage: Was will meine Figur in dieser Situation erreichen? Welche Aktion würde sie in genau diesem Moment durchführen, um sich diesen Wunsch zu erfüllen? Und welche Worte würde sie verwenden, um genau diese Aktion durchzuführen?
Das gesprochene Wort gibt Aufschluss darüber, was eine Figur denkt und fühlt; ihr Agieren jenseits der Worte ist Ausdruck ihrer Identität. Um das Innenleben einer Figur aufzudecken, sollten Sie nach der Aktion im Subtext suchen und sie für sich mit einem Verb im Indikativ Präsens ganz klar benennen. Nachstehend finden Sie noch einmal die vier Zitate aus dem Vorwort. Betrachten Sie bei jedem einzelnen den Subtext und benennen Sie die Aktion der Figur mit einem Verb im Indikativ Präsens. Wenn Sie fertig sind, vergleichen Sie Ihre Analysen mit meinen.
»Und morgen und dann morgen und dann morgen,
So kriecht’s im Schleicheschritt von Tag zu Tag
Zur letzten Silbe hin im Lebensbuch;
Und alles Gestern hat nur Narrn geleuchtet
Читать дальше