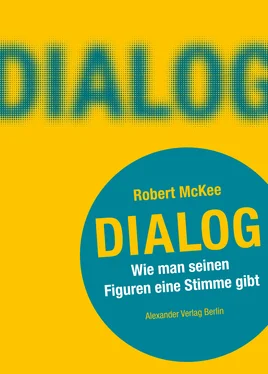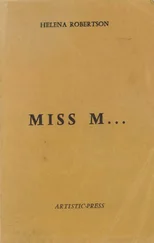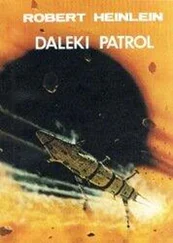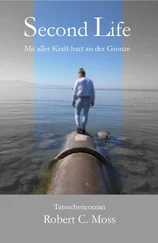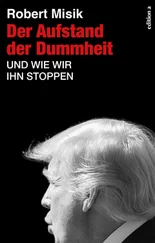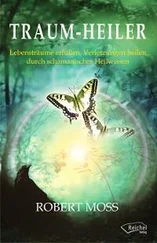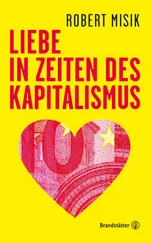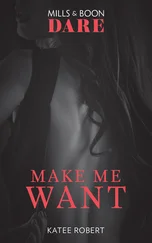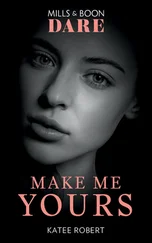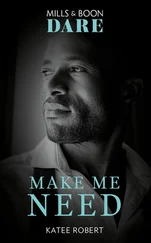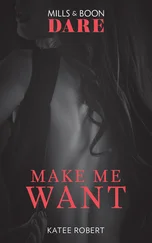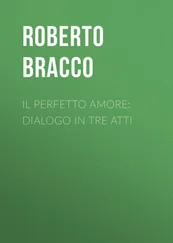Das wahre Wesen einer Figur findet nur dann Ausdruck, wenn sie sich, vom Leben unter Druck gesetzt, dafür entscheidet, einen lebensbestimmenden Wunsch aktiv zu verfolgen. Während die antagonistischen Kräfte immer mehr Macht aufbauen, offenbaren die Aktionsentscheidungen der Figur ihr verborgenes Ich, bis schließlich in einer letzten Entscheidung unter maximalem Lebensdruck ihr ursprüngliches, unentrinnbares Ich aufgedeckt wird. Seit Jahrhunderten schon wird darüber diskutiert, wie bewusst beziehungsweise instinktiv die Motivationen sind, die Menschen zu Entscheidungen treiben. Wie immer es sich damit auch verhalten mag, die Entscheidungen nehmen ihren Anfang in dieser innersten Kugel.
Die Sprache kann also nicht ausdrücken, wer eine Figur tatsächlich ist, sondern nur, wer sie zu sein scheint. Schon die Bibel lehrt, dass wir Menschen nicht nach ihren Worten beurteilen sollen, sondern nach ihren Taten. Der Kreis der Wahrheit schließt sich allerdings erst endgültig, wenn Autoren erkennen, dass Worte Taten sind .
Das Sprechen ist das wichtigste Instrument menschlichen Tuns. Wenn eine Figur etwas sagt, tut sie damit auch etwas. Durch ihr Sprechen kann sie einen lieben Menschen trösten, einen Feind bestechen, um Hilfe bitten, Hilfe ablehnen, Autorität anerkennen, sich gegen eine Autorität auflehnen, einen Preis zahlen, etwas oder jemandem Ehre erweisen und immer so weiter auf der endlos langen Liste menschlicher Aktionen. Dialog drückt sehr viel mehr aus als die Bedeutung seiner Worte. Als Sprache dient er der Charakterisierung, als Aktion aber wird er zum Ausdruck des wahren Wesens.
Von Moment zu Moment ringt Ihre Figur um die Erfüllung ihrer Wünsche; sie agiert und nutzt das gesprochene Wort, um ihre Aktionen durchzuführen. Gleichzeitig aber vermitteln ihre Sprachentscheidungen ohne große Ankündigung ihr bewusstes und unbewusstes Innenleben. Ob nun gelesen oder gespielt, gute Dialoge erzeugen immer eine Durchlässigkeit, die den Lesern/Zuschauern einen Blick hinter den gesprochenen Text erlaubt. Dieses Phänomen macht den Story-Rezipienten zum Gedankenleser.
Wenn Sie eine Seite ausdrucksstarken Dialog lesen oder einer herausragenden Schauspielerin dabei zusehen, wie sie eine komplexe Szene spielt, dringt Ihr sechster Sinn in die Figur ein. Sie entwickeln telepathische Fähigkeiten und wissen oft besser als die Figur selbst, was in ihr vorgeht. Ihr Story-gestähltes Echolot verfolgt die Schwingungen immer weiter durch die unbewussten Strömungen der Figur, bis die Aktionen, die sie im Subtext ihrer Äußerungen ausführt, ihre Identität schließlich preisgeben und Sie ihre tiefsten persönlichen Dimensionen entdecken.
Wenn sich, wie manche Menschen meinen, alles und jedes mit Worten ausdrücken lässt, dann sollten wir lieber mit dem Erzählen von Storys aufhören und stattdessen wissenschaftliche Abhandlungen schreiben. Aber das tun wir nicht, denn die unsagbaren Energien des Unterbewusstseins, am Bodensatz des Seins, sind sehr real und verlangen nach Ausdruck.
Im Dialog vereinen sich diese Bereiche, weil das gesprochene Wort durch alle drei Kugeln nachhallt. Dialoge verfügen über die Doppelmacht, das Aussprechbare zu äußern (Charakterisierung) und dabei das Unaussprechliche zu erhellen (wahrer Charakter) – das, was sich in Worte fassen lässt, gegen das, was nur in Taten zu fassen ist. Daher ist der Dialog auch das wichtigste Vehikel, um Figuren-Inhalte zu transportieren.
Der Grundsatz »Nichts ist, was es scheint« bringt die ursprüngliche Dualität des Lebens zum Ausdruck: Der Schein ist die Oberfläche, die Aktivitäten, die wir sehen und hören, die äußeren Verhaltensweisen einer Figur, das, was sie sagt und wie sie sich gibt. Das Sein ist die Substanz des Lebens, die Aktionen, die eine Figur jenseits der aktiven Oberfläche vollzieht.
Äußere Vorgänge wie Karten spielen, Sport machen, Wein trinken und, allem voran, Sprechen sind schlichte Aktivitäten. Diese auf den Text bezogenen Verhaltensweisen verhüllen die Wahrheit dessen, was eine Figur tatsächlich tut. Denn obwohl eine Aktivität wie die, an einer Bushaltestelle mit einem Unbekannten zu plaudern, völlig zweckfrei erscheinen mag, ist sie das doch nie. Entsprechend ist keine Dialogzeile jemals fertig, bevor Sie sich nicht folgende Frage beantwortet haben: Welche Aktion führt meine Figur im Subtext ihrer verbalen Aktivität tatsächlich aus?
Denken wir einmal ans Eisessen. Ein Eis essen wir nie nur deswegen, weil wir hungrig sind. Wie bei allen Verhaltensweisen liegt dieser Aktivität eine bewusste oder unbewusste Aktion zugrunde. Was macht der Eisesser tatsächlich? Vielleicht will er ja sein Leid durch die Süßigkeit lindern, oder er lehnt sich gegen eine ärztliche Anordnung auf, oder aber er belohnt sich, weil er seine Diät so gut durchgehalten hat. All diese Aktionen – lindert sein Leid, lehnt sich auf oder belohnt sich – finden ihren Ausdruck in der Aktivität des Eisessens.
Mit dem Sprechen ist es genauso. Was tun Figur A und Figur B, während sie miteinander sprechen? Will Figur A Figur B mit ihren Worten trösten oder verspotten? Und wenn B reagiert, suggeriert ihr Dialogbeitrag dann, dass sie sich A unterordnet oder ihrerseits dominiert? Heuchelt A nur Interesse oder verliebt sie sich gerade? Betrügt B A oder legt sie ein Geständnis ab? So geht es weiter mit den Fragen. Welche Subtext-Aktionen liegen tatsächlich hinter den Text-Aktivitäten der Figuren und treiben die Szene voran?
Eine Aktivität ist also nur die oberflächliche Manifestation einer Aktion, eine Art und Weise, auf die eine Figur ihre Aktion ausführt. Aktionen sind die Grundlage des Erzählens, und in jeder Aktivität ist eine Aktion enthalten.
»Drama« (dráma) ist das altgriechische Wort für »Aktion, Handlung«, abgeleitet von dem Verb dráM , das »tun«, »handeln« oder »agieren« heißt. Im klassischen Griechenland wusste das Publikum, dass alle äußerlichen Aktivitäten von einer inneren Aktion angetrieben werden, egal, was an der Oberfläche des Stücks geschieht. Wenn wir dieses Prinzip auf das Schreiben einer Szene ausdehnen, stellen wir fest, dass selbst dem Schweigen noch eine Aktion zugrunde liegt. Es ist eine Aktion, in einer Situation, die eine Äußerung erfordert, nichts zu sagen, vielleicht sogar eine grausame Aktion, die sich gegen einen anderen Menschen richtet. Spricht eine Figur, dann tut sie damit etwas: Sie hilft oder hindert, bettelt oder besticht, überredet oder rät ab, erklärt oder führt in die Irre, geht zum Angriff oder zur Verteidigung über, verteilt Komplimente oder Beleidigungen, beklagt sich oder dankt, und so geht es weiter mit der endlosen Liste der Aktionen. Selbst Pausen spielen in den Beat aus Aktion und Reaktion hinein: Hält eine Figur inne, dann reagiert sie damit entweder auf die vorangegangene Aktion der Szene oder bereitet ihren nächsten Schachzug vor.
Oft wird der Begriff »Dialog« mit dem des »Monologs« kontrastiert, als wäre ein Dialog immer ein zweigleisiger Vorgang. Aber das ist irreführend. Wie schon im ersten Kapitel erwähnt, ist der Begriff »Dialog« eine Kombination aus zwei griechischen Wörtern ( diá und légein ), die »durch« und »Sprechen« bedeuten. »Dialog« meint also Aktionen, die durch das Sprechen erfolgen. Wenn eine Figur mit sich selbst spricht, führt sie in sich Aktionen durch. Der Begriff »Monolog« meint, dass jemand mit nichts und niemandem spricht, was aber in der Realität gar nicht möglich ist. Bei jedem Wort, das jemals geäußert wurde, bei jedem Gedanken, ist immer jemand, etwas oder ein Aspekt des eigenen Ichs der Empfänger.
Parallel zu Aktivität und Aktion verläuft ein weiteres Begriffspaar: Text und Subtext.
Читать дальше