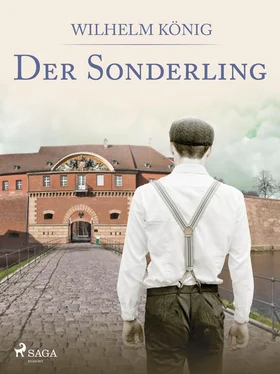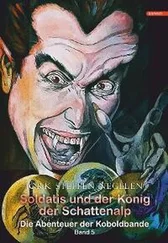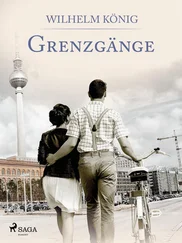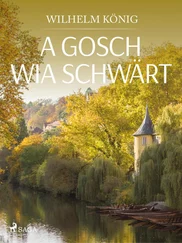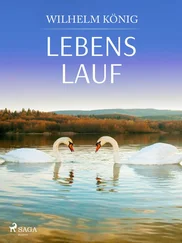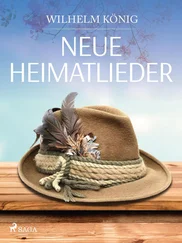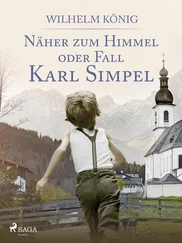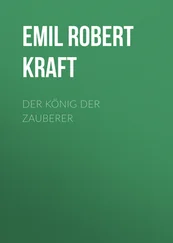Sein Schreiben ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg von der Dunkelheit und Dumpfheit – ist es nicht die Dunkelheit und Dumpfheit seiner Umwelt, die an ihm offenbar geworden ist? – zur wachsenden Bewußtwerdung. Auch Karls Sprache wird zunehmend klarer und politischer. Sein Schreiben ist ein Innehalten vor dem nächsten großen Schritt – einem Schritt hinaus aus der Heimat, einer politischen und geographischen Grenzüberschreitung.
I
Träume oder Der Blick zurück
Seit ich wieder zu Hause bin, seit Frühjahr 1955, träume ich sehr viel, und ich kann oft gar nicht genau unterscheiden zwischen dem, was ich wirklich erlebt habe und dem, was ich nur träume. Jedenfalls ist das meiste vergangen, was ich hier erzähle. Ich blicke zurück – blicke zurück auf Wahres und Geträumtes. Alles kommt nun von sehr weit hinten auf mich zu wie eine große Welle, und ich weiß, daß sie mich verschlingen könnte. Und die Welle rollt auf mich zu, reitet über das Meer, über die See, schwillt immer mehr an: kurz vor meinen Füßen bricht sie zusammen. Das hilft mir aber nicht viel. Die Welle kommt immer wieder, und ich stehe dieselbe Angst immer wieder von neuem aus. Es ist die Angst vor mir selber: die Angst vor meinem Leben, jetzt und zuvor; in Zwiefalten und nach Zwiefalten. Wie in dieser Angst bestehen, gar weiterleben und womöglich ohne Angst? Vielleicht durch Schreiben? Im Augenblick sehe ich keine andere Möglichkeit. Zu sehr bin ich auf mich allein gestellt.
Wenn ich das äußere Bild meines Schreibens beschreiben sollte, so würde ich sagen: Rückwärts gehend und gebückt komme ich aus meiner Geschichte heraus. Dabei schreibe ich auf den Boden, male Zeichen, die die Gespenster – die Geister, die Hexen – nicht überschreiten können.
Tragen oder ertragen muß ich schon wieder viel. Nicht daß man mich verspottet; daß mir die Kinder nachlaufen oder nachschreien – schwätzen werden sie über mich, vor allem die Erwachsenen. Aber das meine ich nicht mit Ertragen. Ich meine das Ganze – das Dorf an sich; die Zeit. Alles geht weiter, als ob nichts geschehen wäre. Keiner hat etwas gesehen und gehört – und etwas Unrechtes getan oder geduldet hat gleich gar keiner von denen. Und am wenigsten hatten unsere Gefangenen, die jetzt nach Hause kommen, mit den Nazis etwas zu tun. Das will ich ja noch glauben. Sie wurden in der Hauptsache eingezogen, und wenn sie da, im Ausland oder fern im Reich etwas Böses angestellt hätten, dann hätten sie die Russen oder Amerikaner noch länger behalten. Also, was will man?
Und die, die den Krieg in der Heimat verbracht haben? Auch nichts! Da hat keiner eine Uniform getragen, eine Fahne geschwenkt oder Heil Hitler gebrüllt – alle nur »Grüß Gott«, »Grüß Gott«: »Jo, wennen sieh«, soviel hat einer allenfalls noch riskiert.
Überhaupt: wo sind die vielen Uniformen und Fahnen alle hingekommen? Zerschnitten, umgearbeitet zu bunten Sommerkleidern und Säcken – so muß ich mir das vorstellen. Und ich muß mir weiter vorstellen, daß ich mit meiner »Tat« 1948 zwischen allen Stühlen sitze und zwischen allen Lagern stehe: zwischen denen, die vergessen wollen und denen, die nicht vergessen können sowie zwischen denen, die vergessen haben und denen, die sich wieder erinnern wollen. Ich will mich ja auch wieder erinnern – doch zugleich möchte ich vergessen, freilich möchte ich erst dann vergessen, wenn ich verstanden habe. Bei allen andern kommt das zum Leben oder zum Glück dazu: bei mir ist es aber das Leben – und das Glück!
Wörter oder Schreiben und lesen können
Ob das Schreiben-und-lesen-Können nun ein Fluch oder ein Segen ist, das wird sich weisen, hätte mein Ahne, der Vater meiner Mutter in dem kleinen Dorf über dem Tal gesagt – und das sage ich jetzt auch! Auch Xaver, der in der Hütte bei Zwiefalten wohnte und vielleicht noch wohnt, von dem ich viel gelernt habe, war dieser Meinung. Xaver hat mir vor allem viel erzählt: von der Welt draußen, vom Krieg und von Abenteuern. Xaver sagte: »Es hat Kulturen gegeben in der Menschheitsgeschichte, die haben keine Schrift gekannt – die Indianer zum Beispiel, und es hat hohe Kulturen gegeben, die haben eine sehr hochentwickelte und komplizierte Schrift gehabt – die Azteken und andere: Alle sind sie untergegangen oder können jederzeit untergehen.«
»Auch Deutschland?« fragte ich dann. »Deutschland?« fragte er zurück. »Das ist doch schon untergegangen; es schwimmt nur noch über Wasser. Und an diesem Untergang sind wir selber schuld. Wir hätten uns niemals mit den Italienern und so Feiglingen einlassen dürfen, dann wäre der Krieg anders ausgegangen!« Xaver war Soldat, und er hat damals den Duce, den Führer der Italiener, zusammen mit anderen aus seiner Gefangenschaft befreit. Das waren schon starke Stücke, die konnte nicht jeder vorweisen in Zwiefalten. »Aber egal, ob Deutschland untergegangen ist oder nicht«, fuhr er fort: »Solange du noch etwas von ihm auf dem Wasser schwimmen siehst, ist es besser, du lernst lesen und schreiben – damit du vom Untergang auch etwas mitbekommst.«
»So ist das?«
»Was?«
»Ha, das: Schreiben und lesen lernt man hauptsächlich, daß man vom Untergang der Welt –«
»– vom Untergang Deutschlands!«
»Daß man vom Untergang Deutschlands etwas mitbekommt?«
»So ist es!«
»Das werde ich mir merken.«
»Hoffentlich!«
Xaver hatte im ganzen zwei Bücher, mit denen er mich traktierte, sobald er gemerkt hatte, daß ich noch nicht lesen und schreiben konnte und damit in der Anstalt, wo sie es mir auch mit Gewalt beibringen wollten, nicht genügend Fortschritte machte. Das erste Buch hieß: »Die Geschäftspraxis in Handel und Gewerbe« und hatte ein Kapitel über Schönschreiben und Rechtschreibung und eine große Zinstabelle am Schluß. Das zweite Buch hieß: »Württembergisches Realienbuch. Große Ausgabe. Bearbeitet auf Grund des Lehrplans für die württembergischen Volksschulen, Stuttgart 1912.« Ich habe ihn nie gefragt, woher er die Bücher hatte. Er hatte sie halt, und mehr brauchte er scheints auch nicht.
Daß er ein Buch von Württemberg hatte, das wunderte mich schon: Denn er war ja nicht aus Württemberg, sondern von Bayern. Das sagte schon der Name Xaver. Xaver – so hat mein Ähne immer von einem gesagt, den er nicht leiden konnte oder der nicht gerade viel vorstellte in der Gesellschaft. Und dann war er sowieso katholisch – bei dem Namen kein Wunder!
Zwiefalten – ich bin ja da nicht in einem »grauen Omnibus« hingekommen, also in einem jener Fahrzeuge, in denen während des Krieges die Dackel und Geisteskranken dort eintrafen. Sondern im gleichen schwarzen Auto – oder auch nur in einem ähnlichen, ich kann das heute nicht mehr so genau sagen –, in dem ich mit dem Kommissar und seinen Polizisten zum Ortstermin in das Dorf fuhr.
Daran erinnere ich mich seltsamerweise heute noch genau. Wir fuhren durch ein großes Tor. Wir stiegen aus und kamen in ein großes Haus. Dort wurde ich von Männern und Frauen in weißen Kitteln in Empfang genommen. Sie waren alle sehr freundlich. Einer der weißbekittelten Männer zeigte mir mein Bett in dem Zimmer, in dem noch andere Better standen, und dann sagte er, ich solle mich ausziehen. Ich müßte oder dürfte zum Baden. Au ja, sagte ich: gegen das Baden hatte ich nichts. Ich hatte Wasser, warmes Wasser, gern. Vorher würden mir noch die Haare geschnitten, sagte der Mann; ich brauchte keine Angst zu haben. Nein, nein; ich hätte keine Angst, sagte ich. Und auch der Frisör war sehr freundlich; er fragte mich, woher ich komme und wie ich heiße. Und ich erzählte ihm alles, und der Frisör lachte und sagte immer nur ja, ja – ja, ja! Und ich sagte zuletzt auch nur ja, ja – ja, ja! In diesen Worten steckte viel und nichts.
Und man sagte mir noch, ich brauche keine Angst zu haben; meine Mutter wüßte, wo ich sei, und sie würde mich auch bald besuchen. Das beruhigte mich wirklich. Und so schlief ich auch sehr tief in dieser Nacht.
Читать дальше