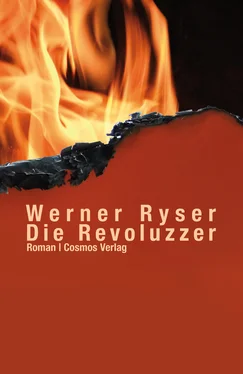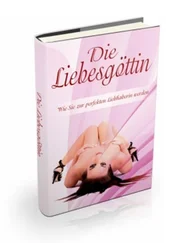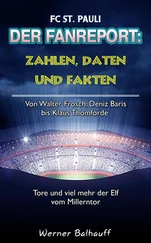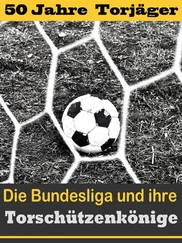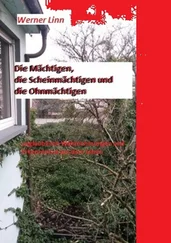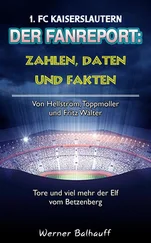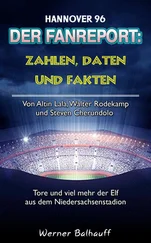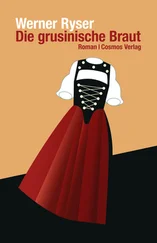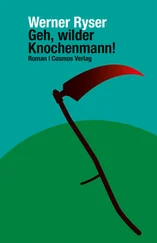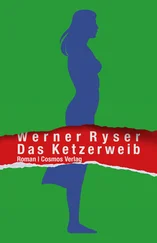1 ...7 8 9 11 12 13 ...18 Es war kalt. Seit dem frühen Morgen waren Wolken aufgezogen, und nun fielen die ersten Schneeflocken. Eine Decke über den Knien, in warme Mäntel gehüllt, Fäustlinge an den Händen und Pelzmützen auf dem Kopf, sassen Mutter und Tochter eng aneinandergedrängt hinter Mathis Jacob im Schlitten. Man schwieg. Dorothea betrachtete die breiten Schultern des Bauern. Ihr wurde bewusst, dass sie seit der Scheidung nie mehr etwas mit einem Mann gehabt hatte. Errötend schob sie den Gedanken beiseite. «Ich möchte wissen», sagte sie schliesslich, «was in Eurem Kopf vorgeht?»
Er nahm sich Zeit mit der Antwort. «Ich frage mich, was Heinrich Bidert wohl sagen mag, wenn ihm seine Kinder einen Louis d’or vom Sternensingen nach Hause bringen.»
«Er wird sich freuen, hoffe ich.»
«Seid Ihr sicher?»
Dorothea glaubte, einen leisen Tadel zu hören. «Ist es etwa nicht recht, wenn man die Bedürftigen unterstützt?»
«Am Dreikönigstag gibt man Esswaren: Brot, Fleisch, Käse …»
«… oder Likör und Tabak», fügte sie spitz hinzu.
Mathis stutzte. Dann drehte er sich um. Unter seinem Bart schien er zu lächeln. «Oder Likör und Tabak.» Dann wieder ernst: «Aber Geld gibt man nicht. Schon gar nicht so viel. Ein Louis d’or entspricht dem, was Heinrich in einem Monat verdient. Mit einem solchen Almosen nimmt man einem Mann, der tagein, tagaus arbeitet, seine Würde. Glaubt mir, er wird sich wie ein Bettler vorkommen. Es sollte mich nicht wundern, wenn er das Geld in die Armenkasse spendet.»
Dorothea schwieg verstimmt. Man hörte die Schellen am Zaumzeug des Pferds. Landschäftler, dachte sie erbittert. Nichts konnte man ihnen recht machen, weder im Kleinen noch im Grossen: Geschenke gaben sie weiter, und selbst die Abschaffung der Leibeigenschaft genügte ihnen nicht. Nein, sie wollten auch von den Abgaben und Zinsen befreit werden und forderten sogar die politische Mitbestimmung. Sie reckte das Kinn in die Höhe: «Ihr glaubt also, Euer Schuh-Heini habe eine Würde, die er verlieren könnte?»
«Sicher glaube ich das.»
Sie sah, wie sich der Rücken ihres Pächters straffte. «Wenn Ihr Euch da nur nicht täuscht.» Und dann verriet sie ihm, dass ihr Pfarrer Grynäus erzählt hatte, Heinrich Bidert berichte ihm regelmässig über das, was in den Hauskreisen, an denen auch er teilnehme, gesprochen werde.
Mathis entspannte sich. Er wandte sich um und lächelte wie vorhin in seinen Bart. «Kann ich Euch vertrauen?»
«Du weisst, dass ich dich nie verraten würde.» Sie hatte, ohne sich dessen bewusst zu sein, zum vertraulichen Du gewechselt, so wie damals in der Jugendzeit, als sie ihre Geheimnisse miteinander geteilt hatten.
«Wir sprechen vorher miteinander ab, was Heinrich Bidert dem geistlichen Herrn erzählen soll. Schliesslich schreibt der Pfarrer regelmässig Berichte über uns an seine Vorgesetzten in der Stadt.»
«Heisst das, dass ihr in euren Konventikeln …» Dorothea Staehelin stockte. War es möglich, dass Mathis Jacob und seine Freunde bei ihren Versammlungen nicht die Bibel, sondern ganz andere Schriften, vielleicht gar rebellische aus Frankreich lasen und darüber diskutierten?
«Vielleicht heisst es das», sagte Mathis, der ihre Gedanken erriet. «Aber fragt nicht weiter.»
«Maman, was ist ein Konventikel?», wollte Salome wissen, die der Unterhaltung der beiden Erwachsenen staunend gefolgt war, ohne zu verstehen, worüber sie gesprochen hatten.
«Ein Konventikel, Kind, ist ein Kreis, in dem sich fromme Menschen im Namen des Herrn Jesu zusammenfinden.» Sie kämpfte gegen einen Lachreiz. «Meistens wenigstens.» Ihr Blick blieb erneut an Mathis’ Schultern haften.
Sie hatten inzwischen Waldenburg erreicht, und der Wächter am oberen Tor winkte sie durch. Der Bauer lenkte den Schlitten durchs Städtchen zum Pfarrhaus, wo tatsächlich der Preiswerksche Kutscher auf Dorothea und Salome wartete.
Theophil Grynäus trat auf den Hof hinaus, um seine Base zu begrüssen und gleichzeitig von ihr Abschied zu nehmen. Er konnte ihr seltsames Lächeln nicht deuten. Ihm schien, sie amüsiere sich auf seine Kosten, aber er mochte sich täuschen.
Dorothea wandte sich an ihren Pächter: «Ihr wisst, Mathis, dass nichts von dem, was Ihr mir anvertraut, weitergeht.» Sie schaute ihm in die Augen und reichte ihm die Hand. Dem Pfarrer schien, sie halte sie unschicklich lang.
Im Winter, wenn es auf dem Hof weniger zu tun gab, sassen Barbara Jacob oder ihre Tochter Martha bis spät in die Nacht beim schwachen Licht einer Öllampe am Webstuhl. Sie verwoben das Garn, das Hilfsarbeiterinnen in der Fabrik in Basel durch die Zwirnmühle gedreht hatten, zu Bändern. Barbaras Vater, Emil Strub, der als Fuhrmann zweimal wöchentlich Waren zwischen Waldenburg und Basel hin und her transportierte, brachte den Faden auf den Hof. Wie die meisten Baselbieter Bandweber bezahlten auch die Jacobs Miete für den Webstuhl, in ihrem Fall an Benedikt Preiswerk, den Bruder von Madame Staehelin. Wie alle städtischen Fabrikanten hatte dieser damit jeden Produktionsschritt, von der Anschaffung des Garns bis zum Verkauf des fertigen Bandes, unter seiner Kontrolle.
Seidenbändel, mit denen man Kleider, Hüte und manchmal sogar Schuhe schmückte, waren beliebt. Aber während die Fabrikbesitzer in Basel reich wurden, waren die Posamenter draussen in der Landschaft schlecht bezahlt. In den Landvogteien des Oberen Baselbiets standen Hunderte von Webstühlen. Man war auf den Zusatzverdienst angewiesen und konkurrierte sich gegenseitig. Das drückte auf die Löhne.
Mit den einfachen Trittwebstühlen, wie sie in den meisten Haushalten standen, konnten im Gegensatz zu den Bändelmühlen, die man in der Fabrik in Basel verwendete, nur einfarbige Bänder produziert werden, die als Massenware in den Verkauf kamen.
Bevor Barbara oder Martha ihre Arbeit aufnehmen konnten, musste das Garn auf Spulen übertragen und die Kettenfäden, den Massen der bestellten Bänder entsprechend, hergerichtet werden. Diese Aufgabe, die viel Zeit in Anspruch nahm, gehörte zu Hannas Pflichten. Anschliessend bereitete die Mutter oder die Schwester den Stuhl vor. Erst zwei bis drei Tage nachdem Emil Strub das Garn geliefert hatte, konnten sie mit dem Weben beginnen.
Wenn sie auf die Pedale ihres Stuhls trat und sich die geraden und ungeraden Kettenfäden gleichzeitig hoben beziehungsweise senkten, sodass sie das Schiffchen von Hand hindurchführen konnte, hatte Barbara Musse, ihre Gedanken schweifen zu lassen. Ihr war bewusst, dass ihr der Bändelherr die Arbeit und damit einen wichtigen Teil des familiären Einkommens jederzeit entziehen konnte. Insofern waren die Jacobs nicht nur als Pächter, sondern auch als Posamenter auf das Wohlwollen von Dorothea Staehelin und deren Bruder angewiesen.
Seit Samuels Unfall wartete Barbara jeweils darauf, dass das städtische Frauenzimmer mit ihrer Tochter wieder nach Basel zurückkehrte. Meinen Goldschatz nannte Madame neuerdings ihren Jüngsten, dem sie eine Montur geschenkt hatte, von der er sich nicht mehr trennen mochte. Barbara biss sich auf die Unterlippe.
In der Nähe dieser vornehmen, stets gepflegten und schlanken Frau mit dem schmalen Patriziergesicht fühlte sie sich klein und hässlich. Sechs Geburten hatten Barbara in den Hüften breit werden lassen. Ihre abgearbeiteten, kräftigen Hände waren rot und voller Risse, und neben Dorotheas kunstvoller Frisur kam sie sich mit ihrem eigenen aschblonden, strähnigen Haar unansehnlich vor. Madame Staehelin war nicht nur schön, sondern auch noch klug, sprach Französisch und Latein, konnte malen und schrieb seitenlange Briefe. Dazu kam, dass sie und ihr Mann in der Jugendzeit einen vertrauten Umgang gehabt hatten. Barbara hatte Mathis im Verdacht, dass er noch heute mehr an die Frau dachte, als ihm guttat.
Bis zu ihrer Heirat hatte Barbara stets im elterlichen Haushalt mitgearbeitet. Sie hatte eine Magd ersetzt, und daran hatte sich bis heute, abgesehen von den zusätzlichen Pflichten als Ehefrau und Mutter, wenig geändert. Sie beklagte sich nicht. Sie wusste, in welchen Stand sie geboren war. Dass sich jedoch die reiche Dorothea Staehelin in ihre Familie drängte, ihrem Mann schöne Augen machte und versuchte, ihr den Kleinen abspenstig zu machen, das schien ihr nicht richtig.
Читать дальше