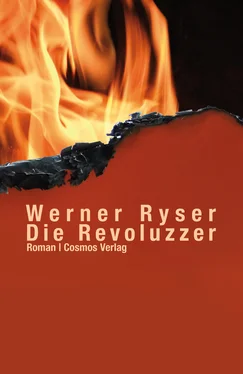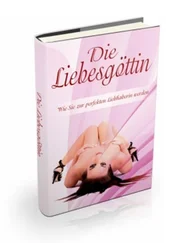Hinter ihr stand Salome. Auch ihr war der Schrecken ins Gesicht geschrieben. «Er ist tot.» Sie stürzte zu ihrer Mutter und vergrub schluchzend den Kopf an ihrer Brust.
So schnell sie konnte, lief Hanna über den Waldweg zur Chlusweid hinauf. Tränen flossen über ihre Wangen. Einmal stolperte sie über eine der knorrigen Flachwurzeln und fiel hin. Sie rappelte sich hoch, ohne auf die blutig geschürften Ellenbogen zu achten. Sie lief weiter, immer weiter. Nur einmal blieb sie kurz stehen und rang nach Atem, dann rannte sie wieder. In der Hand hielt sie das Papier mit der Nachricht von Madame Staehelin, die sie Doktor Alioth übergeben sollte.
«Sag ihm, er soll sich beeilen, vielleicht kann er Samuel retten», hatte sie gesagt. «Und nun lauf. Es geht um Leben und Tod!»
Hanna hatte im oberen Stockwerk die Kinder hüten müssen. «Seid leise», hatte sie gesagt, immer wieder: «Seid leise, wir dürfen die Erwachsenen nicht stören.» Aber Salome und Sämi hatten ihr nicht gehorcht. Sie waren übermütig gewesen, hatten begonnen, Fangen zu spielen und sich gegenseitig durch die Wohnung gejagt. Hanna war ihnen nachgerannt, hatte sie beschworen ruhig zu sein, aufzuhören, hatte gefleht und gedroht. «Sämi!», hatte sie gerufen und «Mamsell Salome!» Vergeblich. Für die beiden war ihre Aufregung ein zusätzlicher Anreiz, Teil des Spiels. Dann endlich hatte sie den kleinen Bruder am Arm erwischt. Sie standen am oberen Ende der Treppe. Sie hielt ihn fest, aber er konnte sich losreissen – und stürzte kopfvoran die Treppe hinunter. Zweimal überschlug er sich. Dann blieb er am Fuss der Treppe liegen. Bewegungslos. Aus seinem Mund und den Ohren floss Blut. Hanna hatte laut geschrien.
Starr vor Schreck waren Vater und Mutter vor dem kleinen, regungslosen Körper gestanden. Der Pfarrer hatte sich im Hintergrund gehalten. Madame Staehelin aber hatte sich von der weinenden Salome gelöst und war neben Sämi auf den Boden gekniet. Sie hatte ihr Ohr an seine Brust gelegt, hatte seinen Puls gefühlt und schliesslich gesagt: «Er lebt noch». Dann hatte sie Anweisungen erteilt: «Ihr, Barbara, müsst das Bett in der leeren Kammer in meiner Wohnung frisch beziehen. Sobald das getan ist, werdet Ihr, Mathis, Euer Kind ganz vorsichtig hinauftragen. Ich denke, dass sein Kopf nicht bewegt werden darf. Und du», sie hatte sich an Hanna gewandt, «wirst nach Langenbruck laufen, zu Doktor Alioth. Du bittest ihn, so rasch wie möglich hierher zu kommen. Ich gebe dir ein paar Zeilen mit. Wenn er fragt, wie es Samuel geht, so sagst du ihm, er sei die Treppe hinuntergefallen. Er habe die Besinnung verloren und blute aus dem Mund und den Ohren.»
«Er lebt noch», hatte sie gesagt. Hanna klammerte sich an dieses «noch». Inzwischen hatte sie das ehemalige Kloster Schönthal erreicht, das vor vielen hundert Jahren, mitten in der bewaldeten Hügellandschaft am Oberen Hauenstein, erbaut worden war. Abermals blieb sie stehen, um Atem zu schöpfen. Ihr Blick fiel auf die Fassade der Kirche. Über dem Torbogen war ein Lamm zu erkennen, das auf seinen Schultern ein Kreuz trug. Links davon war eine Muttergottes samt Jesuskind in den gelben Sandstein gehauen.
Hanna wusste, dass sich die Katholiken drüben im Solothurnischen an die Jungfrau Maria wandten, wenn sie ein Herzensanliegen hatten. Pfarrer Grynäus hatte in der Kinderlehre erklärt, das sei eine Art Götzendienst. Wer den wahren, reformierten Glauben habe, könne sich direkt Gott oder Jesus anvertrauen. Ergriffen von der Innigkeit, mit der Maria das Kindlein in ihrem Schoss betrachtete, schickte Hanna aber auch zu ihr ein Stossgebet. «Lass lieber mich sterben als ihn», flüsterte sie.
Doktor Alioth und seine Frau sassen bei einer Tasse heisser Schokolade und einem Stück Kuchen unter dem grossen Apfelbaum vor ihrem Haus und genossen den Frühsommernachmittag. Karl Alioth war gegen fünfzig Jahre alt. Seine ehemals blonde, inzwischen silbergraue Lockenpracht hatte sich an der Stirn ziemlich gelichtet. Aus seinem runden Gesicht blickten, umrahmt von unzähligen Lachfältchen, zwei kluge blassblaue Augen. Sie weiteten sich erstaunt, als Hanna Jacob durch seinen Garten stürmte und mit hochrotem Kopf, schwitzend und verheult, vor ihm stehen blieb. Vor elf Jahren war er wegen ihr geholt worden, da ihre Geburt mit Komplikationen verbunden gewesen war. Seither hatte er sich ab und zu nach ihrer Entwicklung erkundigt.
«Du bist ja ganz ausser dir, Kind», sagte seine Frau. «Was ist denn geschehen?»
«Sämi!», stiess Hanna hervor, und dann wurde sie von einem Weinkrampf geschüttelt.
Der Doktor strich ihr beruhigend übers schweissnasse Haar. «Nun sag schon, was mit dem Brüderchen ist.»
«Er stirbt», schluchzte Hanna. Sie reichte ihm das zerknüllte Blatt, das ihr Madame Staehelin mitgegeben hatte.
Karl Alioth las die Zeilen. «Er ist also die Treppe hinuntergestürzt?»
«Er ist ohne Besinnung und blutet aus den Ohren und dem Mund und der Nase, soll ich Euch ausrichten», stammelte das Mädchen.
Der Doktor nickte. «Sag dem Knecht, er soll das Pferd satteln», bat er seine Frau. «Ich werde inzwischen die Tasche mit den Medikamenten holen. Und dich nehme ich zu mir aufs Pferd», sagte er zu Hanna. «Unterwegs kannst du mir dann nochmals genau erzählen, was passiert ist.»
Die nächsten Tage wurden für Hanna zu einem einzigen Albtraum. Sämi lag in einer verdunkelten Kammer in Madame Staehelins Wohnung. Der Doktor hatte einen Schädelbruch diagnostiziert und verschiedene Anordnungen getroffen. Er hatte Madame ein Fläschchen mit einer Opiumtinktur gegeben und sie angewiesen, Samuel alle paar Stunden davon fünf Tropfen einzuträufeln. Es gehe darum, ihn stillzulegen, er dürfe sich so wenig wie möglich bewegen. Nur sie dürfe zu ihm. Vielleicht noch ab und zu die Mutter, sonst aber niemand. Samuel brauche Ruhe, absolute Ruhe, ausserdem höchstens Dämmerlicht. Er dürfe auch keine feste Nahrung bekommen. Fleisch- und Gemüsebrühe, das schon, und vor allem Schafgarbentee, den man auch Blutstilltee nenne oder, wie das seine Mutter getan habe, «Heil der Welt». Man müsse ihn mit Honig süssen, denn er schmecke bitter. Aber die zarten, weissen Blüten, die man auf jeder Wiese finde, würden das Blut reinigen und den Kreislauf anregen, hatte er erklärt. Im Übrigen müsse man der Natur ihren Lauf lassen. Wie sich die Sache entwickle, liege in Gottes Hand. Samuel könne sterben oder genesen. Aber auch dann müsse man abwarten, ob keine Schädigung des Hirns zurückbleibe. «Aber davon sagt Ihr den Eltern besser nichts», hatte er Madame Staehelin geraten. «Falls das Schlimmste eintrifft, werden sie es noch früh genug erfahren.» Er selber werde regelmässig vorbeikommen, um nach dem Kleinen zu sehen.
Die Eltern kam es hart an, ihren Jüngsten in der Obhut und Pflege von Madame Staehelin zu belassen, aber sie wagten nicht, gegen die Anweisungen des Doktors aufzubegehren. Beim Abendbrot schöpfte die Mutter schweigend den Haferbrei aus der Schüssel. Alle erhielten ihre Portion. Nur Samuels Teller, den Barbara aufgetischt hatte, blieb leer. Sie mochte sich einreden, solange man auch für den Jüngsten den Tisch decke, bleibe er am Leben. Für Hanna allerdings war dieser leere Teller ein stummer Vorwurf. Niemand sprach mit ihr. Niemand beachtete sie, als Tränen auf ihren Brei tropften. Sie würgte ihr Essen hinunter. In der Nacht weinte sie sich in den Schlaf. Sie biss ins Kissen, um Martha, die mit ihr die Kammer teilte, nicht aufzuwecken. «Hättest du nicht besser aufpassen können?», hatte die grosse Schwester gefragt.
«Hättest du nicht besser aufpassen können?», wollten am nächsten Morgen die beiden Brüder, Peter und Paul, wissen.
Der Vater sagte nichts. Er schaute sie nur an. Vorwurfsvoll? Hanna war überzeugt, dass er ihr die Schuld an Sämis Unfall gab. Sie täuschte sich. Mathis Jacob, dessen heimlicher Liebling sie war, ahnte, wie es in seiner Tochter aussah. Er hätte es aber weder ausdrücken können, noch hatte er je gelernt, dass man anderen mit einem guten Wort wenigstens einen Teil der Last, die jetzt seine eigene Tochter zu erdrücken drohte, von der Seele nehmen konnte.
Читать дальше