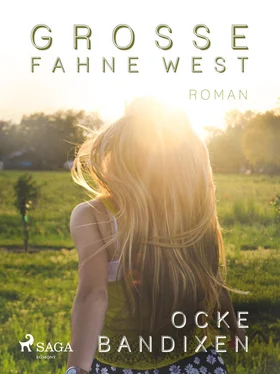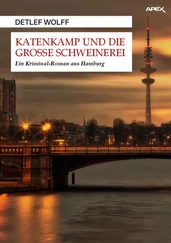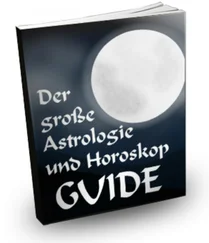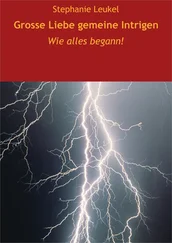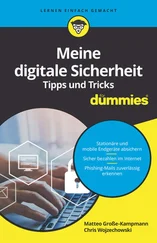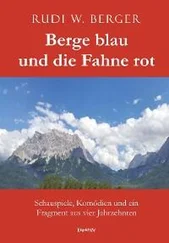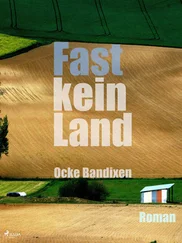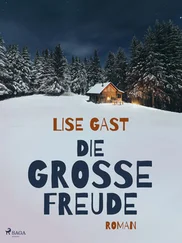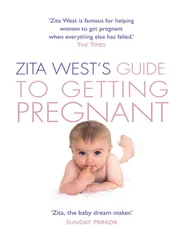Unser Klavier, ein hellbraunes mit schwenkbaren Kerzenleuchtern, gehörte zum Haus, es stand im Wohnzimmer. Es fortzugeben, als meine Mutter starb, hatte nie zur Diskussion gestanden. Als ich klein war, hatte ich den Deckel des eigentümlich riechenden Klaviers angehoben und Töne angeschlagen. Meine Mutter hatte mich ermuntert. Die hohen fielen wie Eiszapfen auf mich. Die in der Mitte schwankten und schwammen, ich hatte das Gefühl, sie strebten zu den hohen Tönen oder zu den tiefen, wollten aber nie bei sich selbst bleiben, sie stritten und rangelten um Aufmerksamkeit. Die tiefen Töne dagegen, die fürchtete ich, sie waren ein Donnern, ein Gewitter, das sich selbst weiter ein Echo spielte. Die Versuche endeten stets ähnlich, angstvoll, verwirrt, es war, als landeten die sich gegenseitig widersprechenden, im Streit vibrierenden Töne in meinen Kopf und fänden nicht mehr heraus. Ich klappte den Deckel stets nach einigen Minuten zu.
Ich hatte ein kleines Zimmer für mich, aber besonders zog es mich in eine Ecke des Wohnzimmers. Dort besetzte das Klavier die eine Seite, ein Lederhocker stand quer vor dem einfachen Plattenspieler. Der Hebel, mit dem der Arm auf die Platten niedergelassen wurde, war mein Schalthebel. Jazzplatten meines Vaters mit umgebogenen Papierhüllen. Namen, die mir bald vertraut waren, Abfolgen von Liedern, Einsätzen, Soli. Ich saß und wippte, klopfte. Wenn ich mich besonders unbeobachtet fühlte, tanzte ich, nur in meiner Ecke, dann an einem der Sessel vorbei, sprang über die Perserbrücke, drehte mich, sank mit ausgebreiteten Armen in den großen Armlehnstuhl, stand wieder auf, als sei ich Gene Kelly, der in unserem Wohnzimmer springt, lacht und überschäumt vor Glück.
Und dann hatte ich ein, zwei Live-Alben, mein Bruder vermisste sie schon nicht mehr, die ich am liebsten im Dunkeln abspielte. Mir war, als könne ich dann die Bühne sehen, die Bewegungen des Trommlers, die Bewunderung erheischende Geste des Gitarristen in Richtung Publikum. Ich war alle zusammen, ich sang, schlug den Rhythmus auf dem Sofakissen, kannte die Soli, ihre kleinen Verzögerungen, ihre Unsicherheiten und übermütigen Gitarrenläufe. Manchmal, wenn ich nach Hause kam, Frerk beim Sport und mein Vater noch nicht da war, führte mein erster Gang in die Ecke mit der Musik. Ich ließ mich begrüßen von Duke Ellington oder Sammy Davis jr., Keely Smith und Louis Prima.
Als ich noch kleiner war, hatte ich den innigen Wunsch ein Mal, nur ein einziges Mal die Plattennadel auf die Gummiunterlage zu senken. Ich war sicher, es war etwas zu hören, vielleicht Musik, vielleicht sprach jemand, was es auch war, es war dunkel, ein Geheimnis, ich müsste es nur probieren.
Dass es verboten war, wusste ich. Knapp gewann diese Seite über den Wunsch. Und dann, nach ein paar Jahren, war der Wunsch verschwunden.
Ich hatte, seit ich denken konnte, Angst um meinen kleinen Finger. Es war der meiner rechten Hand und so manches Mal hatte ich schon gerätselt, warum ich diese Furcht hatte. War ein Erlebnis als kleines Kind schuld? Hatte ich ihn einst in eine Tür, eine Spalte, ein enges Gitter gesteckt und nicht wieder herausbekommen? War er verknickt oder gequetscht worden? Ich wusste es nicht, hatte mir aber die entsprechenden Geschichten derart genau ausgemalt und wieder und wieder durchdacht, dass ich beinahe davon überzeugt war, dass es so oder eben auch anders bestimmt gewesen war. Ich hatte Angst, er würde weg sein, fort und doch präsent. Ich fürchtete den Verlust und den damit zusammenhängenden Schmerz, vor allem aber hatte ich Angst um ihn, wie man um sein Kind Angst hat, das zu einem gehört, aber doch ein Eigenleben führt. Merkwürdig war an dieser Ahnung eines zukünftigen schrecklichen Verlustes auch, dass ich mich nicht um beide kleine Finger ängstigte, sondern nur um den rechten.
Beim Musizieren kam die Angst stets zu Beginn voll in mein Bewusstsein. Später dann ließ sie nach, je länger ich spielte, sie war nicht nur nicht zu spüren oder beiseite gedrängt durch Äußeres. Die Angst war fort.
Später hatte ich ein wenig Klavierunterricht, meine Mutter hörte mir geduldig zu, auch als sie nur noch auf dem Sofa liegen konnte. Ich spielte ihr gern vor, es machte Spaß. Ich quälte mich nicht mit den Übungsstücken, ich spielte, was mir in den Sinn kam und in die Finger fuhr. Ich hatte, auch durch ihre angestrengte Aufmerksamkeit, das Gefühl, ich müsste ihr etwas mehr bieten als ein stumpfes Vom-Blatt-Spielen. Das brachte mir so manches Lied näher, vor allem aber, da bin ich mir heute sicher, das Wesen des Musizierens. Ich warf mich das erste Mal wirklich in die Musik. Ich folgte den Melodien, ich spürte ihrer Natur nach, ihrem Willen, ihrem Rhythmus. Im Vortrag, im Musizieren für jemand wurde mir klar, was ich damit vermochte. »Da kann man ja richtig zu tanzen«, sagte sie einmal. Ein schöneres Kompliment ließ sich nicht denken.
Unser Haus war außen weiß und innen dunkelblau. Mein Vater überzog es über die Jahre nach und nach mit blauschwarzer Tusche, wolkig verwässert an dicken Tropfenpinseln, die er über weißgelbes Papier lenkte. Er malte beinahe jeden Abend, und ich liebte es. Er setzte sich dafür an seinen eigens erhöhten Tisch, die Platte leicht angeschrägt wie in einem Zeichenbüro. Die Neigung hatte er so eingestellt, dass er, auf dem hohen Hocker dahinter sitzend, das Wohnzimmer ganz überblicken konnte und auch selbst nicht verdeckt war. Seine halbe Brille lag neben den Pinselbechern.
Nach und nach füllten sich über Jahre die Wände unseres Zuhauses mit wolkigen, manchmal graustichigen Schiffsbildern, hohen verwischten Himmeln, in denen manchmal wie ein Stück Hoffnung ein überraschendes Orange erschien, manchmal ein Strahl aus einer Wolkenlücke golden. Dazu wühlte und wellte das Meer sich, schäumte gegen die Planken der stolzen Fleuten, Briggs und Barken. Die wiederum maß mein Vater wie ein technischer Zeichner genau ab, las, das Kinn vorgebeugt, die runde Lupenlampe, die, wie Frerk und ich spotteten, sonst halbblinde Hieroglyphenforscher brauchten, über Abbildungen aus seinen zahlreichen großen Bänden mit historischen Schiffen. Sie wurden nicht abgemalt, sie wurden konstruiert, auf ihre Tauglichkeit überprüft und nachgebaut und schließlich in das aufgebauschte, blauschwarze Wasser gelassen. Unten am Rand stets ein Kasten mit dem Schiffstyp, wo er vor allem vorkam, Leistung, Ladekapazität, Vorkommen in der Nordsee.
»Guck mal, jetzt habe ich es.«
Ich war einen Abend so erschrocken, dass er in die Küche kam und mit mir sprach, sprechen wollte.
»Was hast du?«
»Ich habe genau das Rot, genau den Ton, den ich brauche.« Mein Vater zeigte seine Farbprobe vor, dann die Vorlage aus einem Buch.
»Erst hatte ich zu viel Rost drin, und dann zu viel dunkles Braun. Das habe ich dann weiter aufgehellt. Erst mit Gelb, dann mit Weiß, dann wieder Gelb, dann Weiß. Und einen Schuss Schwarz dazu gespuckt.«
»Wirklich?« Ich musste lachen. Es tat gut.
»Klar, du Banause. So ein bisschen Schwarz, das …«
»Das hat doch so ein großer Maler wie du im Mund.«
»In der Seele.«
»Der Seele? Du?«
Jetzt lachte auch mein Vater. Er klopfte mir zwei-, dreimal auf die Schulter. »Wenn du wüsstest, mein Sohn, wenn du wüsstest.«
Ich kann das Klingen der Pinsel in dem dicken, fleckigen Gurkenglas an seinem Malplatz noch hören. Die Farbe, das war mein Lieblingsmoment, wirbelte wie in den Wind ausgestoßener blauer Rauch im Wasserglas. Das Dunkel zerfiel, verwehte in seine rauchigen Spuren. Die Farbe wurde im Wasser freigelassen.
Jeden Dienstag kam der Schifferpastor zu uns. Das tat er, seit meine Mutter tot war, und nie wäre einer von uns dreien auf die Idee gekommen, sein Erscheinen mit dem ewig gleichen, dröhnend gesungenen »’n Abend« in Frage zu stellen. »Bei euch wird zu wenig geredet ohne mich«, hatte der Schifferpastor eines Abends einmal zu uns gesagt und dieses, als ich älter wurde, vorher hatte ich nicht danach gesucht, schien mir der eigentliche Grund seines Kommens zu sein. Inzwischen denke ich, auch ihm, der nach dem Tod seiner Frau Inge, die eine Cousine meiner Mutter war, lange schon allein lebte, die drei Kinder waren längst erwachsen, tat die Gesellschaft unseres wöchentlichen Treffens gut.
Читать дальше