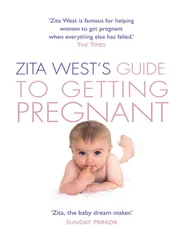Und dann, eines Abends, als ich eigentlich meiner nach einem ausführlichen und dennoch spottbilligen Essen satten und angesäuselten Klasse über die nächste Straße hätte folgen müssen, da sprang die Fußgängerampel auf Rot um. Autos fuhren an, setzten ihren unterbrochenen mehrspurigen Strom fort. Engellena Schmidt trat zu mir an die Fahrbahnkante.
Ich sprach ein tonloses Hallo, sie ebenfalls. Wir guckten geradeaus. Ich seufzte, deutete erst mit dem Kopf, dann, größer, mit Hand und Arm meiner besoffen selig abrauschenden Klasse hinterher. Man wollte nach dem Gelage noch weiterziehen.
»Die sind weg.«
»Ja, das denke ich auch.«
»Ist eh nicht der Weg ins Hotel.«
»Nee, die gehen auch noch nicht ins Hotel, die gehen noch weiter.«
»Und du?«
»Ich weiß nicht.«
»Ist ganz leicht.«
»Was?«
»Na, der Weg ins Hotel.«
»Ja, hier am Ufer entlang, oder? Und dann über eine der Brücken.«
»Weißt du auch welche?«
Wir gingen zusammen, sie rechts, dahinter der Fluss, der golden blinkte, links von mir die Straße, also nichts. Wir liefen lange, wunderbar lange. Ich hielt ihre Hand fest, als sie auf der Mauer balancieren wollte. Ließ sie nicht mehr los. Dann balancierte ich, und sie hielt mich fest. Sie spielte mit meinen warmen Fingern. Wir bogen ein, auf eine der Inseln, die im Fluss lagen, als seien sie dort, mitten in der Stadt, eingefangen worden und mit einer Brücke ans Land vertäut. Ich zog sie an mich, wir küssten uns.
Engellena Schmidt war schmal und schön. Sie hatte dunkle, wehende, ein bisschen lockige Haare, die in die Augen fielen. Ein kleiner Sehfehler irritierte mich. Ein roter, spöttischer Mund. Im ersten Moment dachte ich, dass ihre kräftige dunkle Stimme gar nicht zu ihrem Äußeren passte.
Am nächsten Abend trafen wir uns wieder. Es war, als müsste es so sein. Verabredet hatten wir uns nicht. In dem Haus auf der Insel waren alle hohen Fenster erleuchtet. Musik schwebte mit dem goldenen und weißen Licht nach draußen. Engellena saß auf einer der Mauern am Fluss und schaute. Und ich kam dazu.
Heinrich Hebarth Neutonsen wünschte nicht, Opa genannt zu werden. Großvater, das hatte die Spannweite, die ihm gefiel. Großvater, das klang nach seiner eigenen Kindheit. Wir nannten ihn also Großvater, auch wenn er nur der übrig gebliebene Schwiegervater unserer Tante war. Aber sonst hatten Frerk und ich ja keinen mehr.
Er hatte zwei Weltkriege mitgemacht, die Hungerwinter, die Gefangenschaft, wenn auch nur kurz, er war ja nichts Dolles gewesen, wie er immer wieder einmal fallen ließ, die Währungsreform, zwei schwere Sturmfluten, und war durchgekommen. Das bleibt wie das Land, pflegte er mit seiner heiseren Stimme zu sagen und zog den Hosenbund noch höher, der ohnehin schon grotesk über dem Bauch saß wie ein Deckchen auf einem Tisch. Wir sahen ihn nicht oft, nur bei großen Festen oder bei unserer Tante Trudi, sie holte ihn regelmäßig zum Kaffeetrinken zu sich.
Aber dennoch war er stets bei uns durch die Geschichten über ihn: wie er mit Feldherrnattitüde durch unsere Kleinstadt schlich, was er Unpassendes in der Sparkasse gesagt, wen er treffsicher beleidigt hatte. Dabei war er kein böser Charakter, er war nur angewidert von Mittelmaß, Duckmäusertum und Langeweile. Mit Trudi verstand er sich gut. Meistens. Eine der viel erzählten Geschichten über ihn ging so:
Als Heinrich Hebarth Neutonsen vor ein paar Jahren im Rundfunk die Warnung gehört hatte vor einer zu erwartenden Sturmflut, hatte er einen Einkaufswagen voll Buttermilch und Zwieback gekauft, Dutzende Tüten, und schließlich samt Einkaufswagen zu seinem Haus gekarrt.
Sollte die Flut doch kommen, er würde gewappnet sein. Hunger und Durst, nicht mit ihm!
Derlei Ausfälle waren selten, kamen aber immer mal wieder vor. Meistens ärgerte sich meine Tante aber ebenso sehr über die kleinen Dinge, wir dagegen, Frerk und ich, amüsierten uns königlich über jede Anekdote des Großvaters. Einmal hatte er versucht, mit einer Kerze den Kühlschrank abzutauen. Glücklicherweise dann aber die Tür geschlossen, so dass die Kerze ausging. Ein anderes Mal hatte er nachts vor seinem Haus miauende Katzen mit brennenden Wunderkerzen beschossen, um sie zu vertreiben. Trudi musste anschließend stets die Nachbarschaft oder die Polizei, vor allem aber ihre eigenen Nerven beruhigen.
Also langsam, sagte sie daraufhin stets, mache sie das nicht mehr mit. So langsam.
Die Geschichten über den Großvater gehörten zu jedem ihrer Besuche dazu.
»So etwas macht der immer mit mir. Mit mir. Verstehst du? Dabei ist er noch nicht einmal mein eigener Vater!«
Tante Trudi faltete das Geschirrtuch auf Kante und legte es passgenau in das Muster der Wachsdecke. »Lange gucke ich mir das nicht mehr mit an. Lange nicht mehr!« Sie legte die Decke immer auf, wenn sie kam, um zu putzen. Wir machten auch sauber, aber in ihren Augen und unter ihren Fingern nicht gründlich genug. Sie dieselte einen gelben Wolllappen mit der gleichen Möbelpolitur ein, die in der Flasche nicht weniger wurde, und wischte über alles, was für die kleine Frau erreichbar war, Holz oder nicht.
»Aber er hat doch nur noch dich.« Es waren die immer gleichen Worte, wie in einem unsterblichen Sketch.
»Schwiegervater gut und schön, aber alles kann er auch nicht mit mir machen.«
»Wie alt ist er inzwischen?«
»76.«
»Na, also!«
»Ja, na also!«
Ich hatte die Gewohnheit auch in der Oberstufe noch nicht abgelegt, am Küchentisch meine Schularbeiten zu machen. Wörterbücher, Lexika, Mappen und ein Stiftebecher lagen und standen im offenen Fach des Küchenschrankes. Beschwert hatten sich Frerk und Vater nicht, wahrscheinlich war es ihnen noch nicht einmal aufgefallen.
Tante Trudi kochte Tee, Kaffee war schlecht für Heranwachsende. Sie guckte in die Porzellandose, auf der in Sütterlin »Mehl« stand und wo das Haushaltsgeld aufbewahrt wurde, und schnalzte.
»Müsst morgen noch einkaufen.«
»Ja, ich weiß.«
»Ist wichtig, Peter. Und kauft keinen Fisch bei Dorlemanns, der ist immer so alt. Und denk dran, dass ihr genug Brot habt, das kann man einen Tag liegen lassen.«
»Dann bekommt es einem auch besser.«
»Dann bekommt es einem auch besser.« Trudi goss das heiße Wasser aus dem Kessel in den Becher, schwenkte den Früchteteebeutel umher und stellte mir das Ganze zwischen Heft und Buch.
»Hier. Bis bald.«
»Ja, danke. Bis bald.« Ich stand auf, die kleine Tante Trudi drückte mich an ihre Brust, riss sich dann melodramatisch los, nahm ihre zusammengelegte Plastiktüte und ging zur Küchentür hinaus.
Ich wartete einen Moment und goss dann den Früchtetee weg.
Es war etwas Besonderes, ganz aus dem Norden, ganz aus dem Westen zu kommen. Die Stadt, oder eher das Städtchen, in dem wir lebten, das Ei aus dem wir kamen, lag selbst am Rand. Hinter dem Apfelhaus kamen die Wiesen und dann das Wasser. Die Grenze, der letzte Garten vor dem Meer war unserer. Uns erreichte der Westwind zuerst und die Zeitung zuletzt.
Die Spötter, die über unsere Herkunft und unser Haus herfielen, regelmäßig, ermüdend, taten dies nie ohne eine gewisse Achtung. Die, die dort draußen, die da hart am Wind leben. Große Fahne West, am Rand, kurz vor Schluss – sagten sie. Die Gleichförmigkeit und das Formelhafte der Bemerkungen hatten mich stets verblüfft. Ich hatte mich an das Gedicht erinnert gefühlt: Hohes, hartes Friesengewächs.
Ich könnte behaupten, Anna sei der Magnet gewesen, warum ich ständig in der Kirche oder im Gemeindehaus war, aber das stimmte nicht. Dass sie auch dort war, zumindest manchmal, erfreute mich.
Ein Grund, neben meiner empfundenen Verpflichtung dem Schifferpastor gegenüber, war: Ich machte Musik und dort konnte ich es, mehr noch als zu Hause und ungestörter. Der schwarze Flügel mit seinen gut eingespielten Tasten zog mich an. Es passte, ich konnte es, es machte mir Spaß. Weder mein Vater noch Frerk hatten Talent oder Zeit dafür, was mich darin bestärkte, weiter und mehr zu musizieren.
Читать дальше