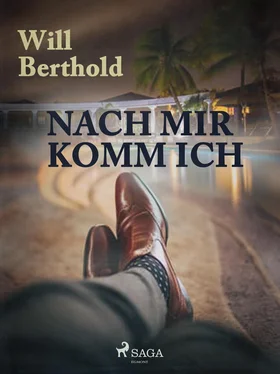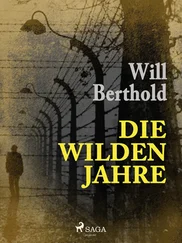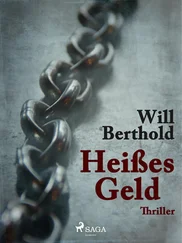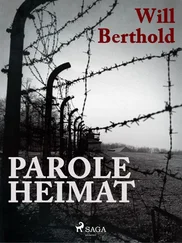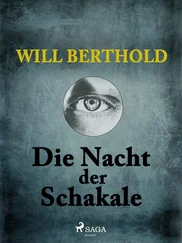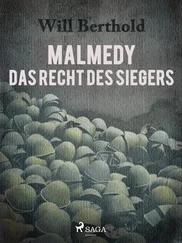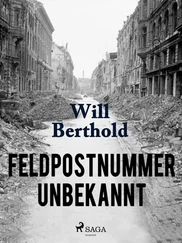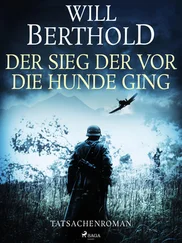Ein Ort, den man kaum auf der Landkarte gefunden hat, ist weltberühmt geworden, weil das einstige Fischernest allen Gastfreundschaft gewährt hatte, den Aussteigern wie den Einsteigern, den Satten wie den Hungrigen, den Verschwendern wie den Nassauern.
Problemgäste, so dämmert es Polizeichef Farinelli, sind erst die letzten Zuwanderer, die Millionäre mit ihrem Schikkeria-Troß.
Schon am frühen Morgen strengt sich der neue Sonnentag an, als wolle er den gestrigen an Glanz noch überbieten. Um neun Uhr morgens wirken die Hänge über dem Westufer des Lago wie mit Gold überzogen. Die Sonne klettert weiter, dem Gipfel des Ghiridone entgegen. Der Schönwetterdunst hebt sich wie ein Vorhang über dem See, der Blick reicht jetzt über die Inseln weit nach Italien hinein.
In den Luxusvillen mit den Parkgrundstücken der Steinreichen, Neureichen und Scheinreichen schlafen die Bewohner noch. Etliche müssen sich vom nächtlichen Alkoholgenuß und Bargeschwätz erholen und Kräfte für die Strapazen des heutigen Müßiggangs sammeln, aber es gibt eine schweigende Mehrheit von Neusiedlern, die keine Schlagzeilen macht und im Tessiner Paradies zurückgezogen und unauffällig lebt, ohne an dem Narrentreiben des Amüsierpöbels teilzunehmen.
Nicht nur Schwärmer nennen die Region zwischen Locarno und Brissago den schönsten Landstrich der Südschweiz. Noch verschleiert die Blütenpracht, daß der traumschöne Fleck mit der herrlichen Aussicht auf die schneebedeckten Berge von Herrschaftssitzen und Ferienhäusern zersiedelt wurde. Hübsche architektonische Einfälle stehen neben monströsen Protzbauten. Einem der Superreichen ist es gelungen, die untere Strecke eines zweitausend Jahre alten Römerwegs einreißen und für seine Autozufahrt asphaltieren zu lassen. Die Legionärsstiefel des großen Geldes trampeln über Geschichte, Kultur und Landschaftsschutz hinweg.
Der Verleger Kronwein wohnt in Moscia, in dem weißen weiträumigen Gebäude inmitten einer schönen Gartenanlage, zwei Kilometer von Ascona entfernt und fünfzig Meter hoch über dem Schweizer Becken des Lago Maggiore. Überzeugt, daß Kamossa sein Desinteresse an dem Manuskript nur vortäuscht, in Wirklichkeit jedoch darauf brennt, es einzusehen und einzusargen, hat er gestern den ganzen Nachmittag über vergeblich auf einen Rückruf des Macht-Moguls gewartet. Am Abend war es dem Ungeduldigen mit dem leicht schwammigen, aber noch immer jungenhaften Gesicht gelungen, sich aus dem Haus zu stehlen und Carlotta ein paar Stunden zu entfliehen, um Abwechslung im Dorf zu suchen und dabei vielleicht Kamossa ›zufällig‹ zu begegnen.
Der Endfünfziger hat mit nichtssagenden Leuten gespeist und ist dann im ›Club‹ hängengeblieben. Whisky auf Vorrat in sich hineinschüttend, hat er verdrossen den hübschen Mädchen auf dem Parkett zugesehen. Sicher hätte er die eine oder andere beim Blondschopf packen können, aber er wollte mit ihr ins Bett und nicht aufs Parkett. Es ist schon ziemlich spät geworden, als er mißmutig in die häusliche Schlangengrube zurückfindet, die ausgerechnet den romantischen Titel ›Villa Paradiso‹ trägt. Carlotta hat sich in ihr Schlafzimmer eingesperrt – es wird Ärger geben.
Der Spätheimkehrer quartiert sich in seinem Arbeitszimmer ein wie in einer Ausnüchterungszelle. Er kann nicht richtig schlafen und erhebt sich beizeiten, ergeht sich im Garten, immer in Hörweite des Telefons.
Zehn Uhr. Der schweizerische Rundfunk bringt Nachrichten. Nichts Besonderes. Am Ende der Wetterbericht: Die Meteorologen sagen für die Südschweiz ein langes Hoch voraus, aber in diesem Moment hört der Verleger, daß seine Frau aufgestanden ist, und stellt sich auf ein Sturmtief ein.
Die Unterlippe hängt durch wie ein schlaffes Sprungseil; er fürchtet, haßt und begehrt Carlotta. Er hatte ihr schon nachgestellt, als sie noch mit einem bekannten Regisseur verheiratet war, dessen Karriere in einer Trinkerheilanstalt beendet wurde. Inzwischen sind fünfzehn Jahre Gemeinsamkeit über das Verlegerpaar hinweggewalzt; eine Zeit enormen wirtschaftlichen Erfolgs über den Abgründen des Privatlebens. Die Gefühle der Kronweins – so es sie je gegeben hat –, wurden zersägt wie die Jungfrau in der Schaubude.
Carlotta hat ihrem Mann nicht nur das Trinken, sondern nahezu alles verboten, und er übertritt nahezu alle Zwänge mit Wonne. Er wird von ihr laufend auf Abwegen ertappt – und dafür bestraft. Die Versöhnungen arten jedesmal in Exzesse aus.
In letzter Zeit sind sie seltener geworden. Kronwein ist der abwegigen Spiele müde. Er ist es leid, von seiner Frau als ewiger Zweiter behandelt zu werden, weil ihm von Carlotta der Regisseur ständig als der Genialere, Berühmtere und Attraktivere vorgehalten wird. Dabei hat der Verleger im ersten Liebesrausch seine Frau zur Mitbesitzerin seines Unternehmens gemacht. Das war sein größter Fehler; daß er es nunmehr täglich feststellt, ändert nichts an der Tatsache.
Carlotta ist keine stille, sondern eine laute Teilhaberin. Sie hat sich in München neben seinem Arbeitszimmer ein Studio als Beobachtungsstand eingerichtet. Von hier aus mischt sie sich ständig in Geschäfte ein, von denen sie nichts oder wenig versteht. Sie fuhrwerkt in der Personalpolitik herum, verfügt Einstellungen oder Entlassungen nach hausgemachten astrologischen und graphologischen Gutachten. Trotzdem kann sie nicht verhindern, bei ihrem Mann immer wieder Taschentücher zu finden, die dieselben roten Flecken aufweisen wie das Rouge auf den Lippen ihrer weiblichen Günstlinge.
Bei Carlotta wurde es zum Wahn, den Ungetreuen an die Dressurleine zu nehmen, wie es bei ihm zum Zwang wurde, sich von seiner Herrscherin loszureißen.
Kronwein hört sie kommen; gleichzeitig klingelt das Telefon.
Der Anrufer ist Kamossa, er trifft eine Verabredung zum Mittagessen.
»Also 13 Uhr 30 im ›Ascolago‹, Herr Kamossa«, bestätigt der Verleger, legt auf und wendet sich der Eintretenden zu.
»Guten Morgen«, begrüßt er sie eilfertig, aber sie antwortet nicht.
Ihr Gesicht wirkt wie versteinert. Sie trägt einen knappen Bikini unter einem seidenen Morgenmantel, der den Blick auf ihre mollige, aber noch immer respektable Figur mehr freigibt als verhüllt. In ihren wasserblauen Augen brennt das kalte Feuer einer rachsüchtigen Domina, die statt der Peitsche Schriftstücke in der Hand hält.
Kronwein stellt mit Erschrecken fest, daß Carlotta während seiner Abwesenheit seinen Schreibtischschlüssel gefunden und in seinen Papieren herumgewühlt haben muß. Er überlegt, worauf sie gestoßen sein könnte, aber das ist schwierig; wenn sie die Fundgrube tatsächlich aufgeschlossen hat, ist es so, als würde ein Klorohr platzen.
»Diesen Kamossa werd ich diesmal ordentlich aufs Kreuz legen«, sagt er zu Carlotta. »Diesen arroganten Pinkel.«
»Und wen hast du heute nacht aufs Kreuz gelegt?« fragt sie mit einer Stimme, die tief von unten kommt.
»Unsinn!« wehrt er ab. »Ich hab ein paar Leute getroffen und bin eben …«
Carlotta tritt näher an ihn heran. »Du hast wieder getrunken«, stellt sie fest. »Und du stinkst wie ein andalusisches Freudenhaus. Sag dieser Schlampe, daß sie gefälligst ihr Parfüm wechseln soll.«
»Eifersucht macht duftblind«, versetzt Kronwein.
Das Hausmädchen rollt den Frühstückswagen auf die Terrasse und unterbricht dadurch den Schlagabtausch, aber gleich wird sich die Szene einer Ehe fortsetzen.
Carlotta greift das Stichwort auf. »Eifersucht?«, versetzt sie. »Lächerlich! Oder meinst du, daß ich deinen Pimmel überschätze?« Früher hat es ihn besonders amüsiert, daß Carlotta von einem Moment auf den anderen aus der Haut der feinen Dame schlüpfen und hundsordinär werden konnte. »Du weißt doch selbst am besten, was ich alles anstellen muß, um deinen lächerlichen Minimax ab und zu noch mal hochzubringen.« Sie trifft ihren Mann am Punkt.
Читать дальше