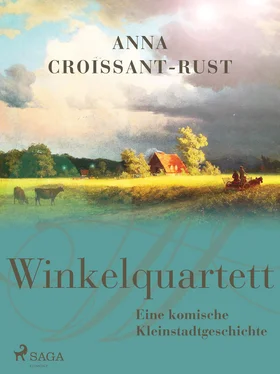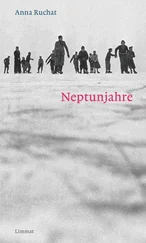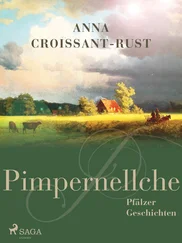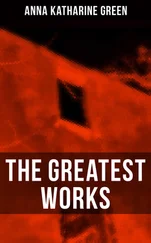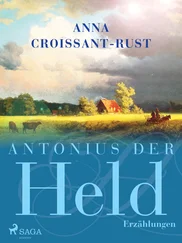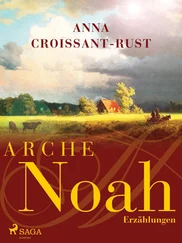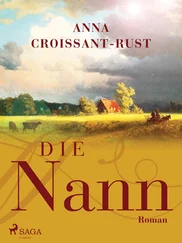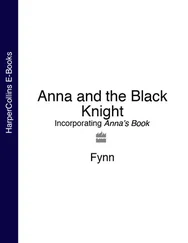Viel Wesens wurde aus der Hinkerei nicht gemacht, der Alte lachte ihn aus und die Mutter war verwundert.
„Schau schau, jetzt hinkst ja gar“ meinte sie, dann ging man wieder zur Tagesordnung über. Da schon drei Rangen umherliefen und ein Kleines in der Wiege schrie hatte niemand Zeit, sich um solche Lappalien zu kümmern, denn jedes hatte alle Hände voll zu tun. Der Meister musste den ganzen Tag hämmern und klopfen, um die Mäuler all der Menschen und Menschlein zu stopfen, und die Frau musste sich tummeln, um sie leidlich zu waschen und zu bekleiden. Zum ganz Bekleiden langte es sowieso nicht, besonders bei Maxl. Wer würde sich denn auch besonders um den Maxl kümmern?
Er war zwar der Mitverdiener, denn das Kostgeld, das der Baron schickte, war reichlich und traf prompt ein. Aber es kam hauptsächlich den andern zugute, für den Maxl reichte es immer nicht mehr recht.
Von „Montur“ war schon gleich gar keine Rede. Wenn’s nur am Körper hielt, das war das Ausschlaggebende. Ob’s lang oder kurz, dünn oder dick, ganz oder zerrissen war, beschwerte die Gemüter der Eltern nicht; es fiel auch in der Paradeisgass durchaus nicht auf, und dem Maxl selber kam schon gar kein Gedanke darüber. Er wusste ja von nichts anderem, und die übrigen Rangen, die mit ihm im Staub herumkrochen oder im Sand wühlten, oder die hordenweise die Paradeis- und die benachbarte Lange Gasse unsicher machten, sahen um kein Haar anders aus als er; die grössere Anzahl war sogar gekleidet richtig wie im Paradiese, besonders zur Sommerszeit.
Wäre das Gezänk der Weiber und das Geschrei der wilden Paradeishorden nicht gewesen, man hatte wirklich an eine paradiesische Idylle glauben können. so unberührt von dem Leben in den Strassen draussen blieb das kleine Gässchen, an dessen Ende das graue Tor mit dem grotesken Spitzdach stand, flankiert von den Stadtmauern mit ihren Schiessscharten und alten Kugelnarben Ueber die Mauern schauten die grünen Alleebäume; es sah aus, als ob es immer so weiter ginge im Grünen. Von fern hörte man das Gemurre des Stadtbaches an dem Wehr der Obermühle, ein Wagen kam nie durch die Gasse, dazu war das Pflaster zu holperig und der Weg zu eng. Wie in einem Dorf, so leer und still konnte es zu Zeiten aussehen, wenn die Kinder des Paradieses gefüttert wurden und die Megären, die die Wächter dieses Edens ohne flammende Schwerter darstellten, auch mit dem Munde etwas anderes zu tun hatten als einander oder einen ahnungslosen Fremdling, der sich hineinverirrte, durchzuhecheln.
Die Tage glichen sich, und der Anblick eines fremden Gesichtes, sei es Mann, Weib oder Kind, versetzte die ganze Paradeisgasse in Aufruhr.
Wie gross war erst der Aufstand, als einmal am Eingang der Gasse ein Wagen hielt und Versuche machte, in das enge, gewundene Gässchen mit seinem buckligen Pflaster einzudringen! Nicht nur ein Wagen war’s, en gewöhnlicher Wagen, nein, eine Herrschaftskutsche mit einem Wappen an der Tür, einem feinen Kutscher auf dem Bock und einem Diener, der einen rehfarbenen Rock anhatte bis auf den Boden hinunter, der den Wagenschlag öffnete und ein „Buckerl“ machte so tief, wie man’s gewiss nur vor „Heil unserm König Heil“ tat!
Im Nu wimmelte es wie in einem Ameisenhaufen in dem engen Gässchen, im Nu waren alle Fenster geöffnet, obwohl es schon herbstlich kühl war und der Wind die dürren Blätter von den Bäumen herein bis vor die Türschwellen wehte.
„An Eklibasch,“ schrien die Rangen und tanzten auf und ab, und die phantasiereicheren riefen: „A königliche Eklibasch!“ Alle Fenster waren besetzt, ungewaschene alte und junge Weiber mit strähnigem Haar hingen heraus, sämtlich in farbigen Nachtkitteln, wer zur Hautvolée des Paradieses gehörte, wohl auch in weissen, was immer etwas gemissbilligt wurde, weil es Ueberhebung anzeigte.
Wie ein Lauffeuer ging es durch die Gasse: „Zum Schuaster Greiner wollen’s!“, denn nach dem hatte der Bediente gefragt, und da einer der Buben des Meisters gerade auch anwesend war, lief der wie besessen die Gasse hinunter, heim, und schrie gleich zur Haustür herein: „Laou dir sag’n, Vater, an Eklibasch kimmt zu uns!!“
Der Meister, der der Märe nicht traute, trat kopfschüttelnd vor das Haus, aber die Mutter, ahnungsvoll, käsweiss vor Aufregung und gerade in keiner Verfassung, die sie zur Hautvolée der Paradeisgasse stempelte, kriegte den überraschten Maxl beim Grips, zog ihn aus dem Laden in die Nebenstube, wo sie zuerst ganz entgeistert hin und her rannte und ihm nur immer mit ganz veränderter, fast heiserer Stimme zurief: „Maxl, jetza nimm di z’samm, jetza nimm di z’samm!“
Der Maxl, verschüchtert durch das aufgeregte und ungewohnte Wesen der Mutter, stand steif wie ein Opferlamm, liess sich die Kleider stückweise vom Leibe reissen — allzuviel waren es ja nicht —, liess sich die Sonntagshose des kleineren Bruders anziehen, er selbst besass keine, in die Joppe einpressen, die ihm am Halse mit fieberhaften, aber dennoch resoluten Fingern zugehakt wurde, obwohl es viel Kraft kostete, denn der Stehkragen war zu eng, und der Hals ergab sich erst, nachdem er einige Falten gemacht. Freilich fuhr der Maxl sofort mit zwei Händen nach oben, aber die Mutter drohte: „Du untersteh di nur!“, ganz leise sagte sie’s, den draussen hörte man schon fremde Stimmen, aber ihre Augen sahen dabei aus, als wollten sie den Maxl an die Wand nageln.
Dann wurden ihm die „Haferlschuh“ eben desselben Bruders an die Füsse gezwängt, dass die groben, grauen Wollstrümpfe mit zwei traurigen Blasen über den Rand der Schuhe standen. Die Mutter erwischte in ihrem Hin- und Herlaufen einen Lappen, mit dem sie ihm übers Gesicht fuhr, wobei sie besonders die Nase aufs Korn nahm. Da aber durch irgendeinen Zufall der Lappen voll Sand war, protestierte der Marl was leider zur Folge hatte, dass nur noch hingebender gescheuert wurde, bis ein seltener und intensiver Glanz auf seiner graugelben Haut erschien. Ferner schwebte noch, zwar kein Damoklesschwert, aber ein grobzähniger Kamm über seinem Haupte, dessen Zähne sich mit solcher Vehemenz in seine sarblosen schütteren Haare eingruben, wie wenn sie Furchen im Kopf zu hinterlassen bestimmt wären
Da ward auch die Tür schon aufgetan und Meister Greiner mit rotem, konfusem Gesicht und zerwühltem Haar darüber rief herein:
„Den Marl möchten die Herrschaften sehen, tua ihn ausser, Lieserl!“
Das Lieserl die Meisterin, schob den Marl vor sich her und getraute sich in der Stube gar nicht, die Augen aufzuschlagen. Nur von unten her warf sie die Blicke nach der anwesenden stattlichen Dame, deren Röcke bei jeder Bewegung wie Seide knisterten, während sie doch erstaunlicherweise nur ein hellgraues Wollkleid trug: noch ängstlicher schaute sie auf den Herrn, den sie beinahe nicht mehr erkannt hätte, dessen Haar schon dünn und dessen Bart grau geworden war.
„Ach Gott! Ach Gott!“ Die Tränen stürzten ihr aus den Augen und fieberisch und dabei unbeholfen, in Seelennot und Spannung wischte sie Stuhl um Stuhl mit der Schürze ab, in fliegender Hast und in der Pose: „O Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehest unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort“, doch niemand machte Miene die Stühle benutzen zu wollen, und niemand achtete ihrer, nachdem die Baronin einmal einen kleinen malitiösen Seitenblick nach ihr getan.
Vor der Tür stand der Bediente Schildwache, damit die Menge, die die vornehmen Herrschaften bis dahin begleitet hatte, nicht hereinflute.
Der Meister hatte jetzt ganz die Stellung eines Impresario angenommen, gefasst, würdig, fast überlegen, seit er sich von der tadellosen Equipierung des Maxl überzeugt hatte.
Maxl selbst, der Held des Ganzen, stand mit einer Armensündermiene mitten in der Stube vor der seidenrauschenden Dame und dem fein duftenden Herrn; er hatte das deutliche Gefühl, dass man ihm im nächsten Augenblick die Joppe aufknöpfen und dass dann sein wüstes, schmutziges und zerschlissenes Hemd offenbar würde.
Читать дальше