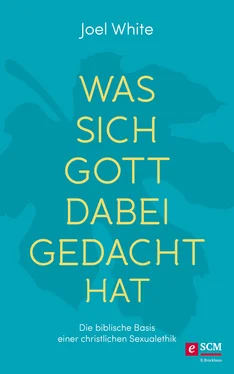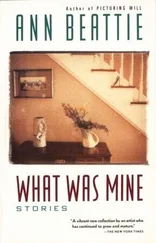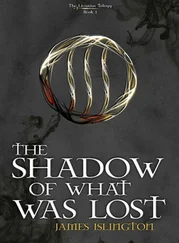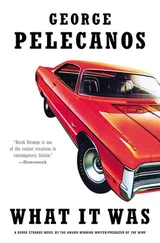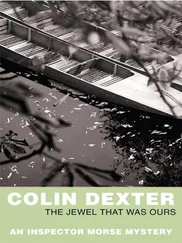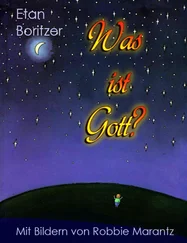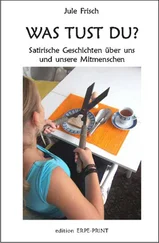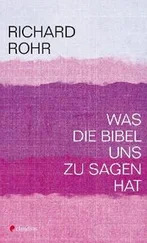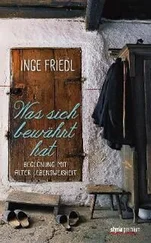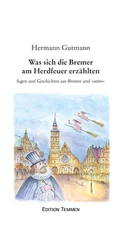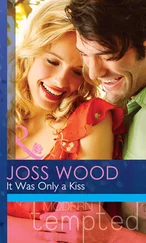Bibelwissenschaftler machen sich Gedanken über Methoden der Auslegung. Das nennt man »biblische Hermeneutik«. Ich habe seit zwanzig Jahren das Privileg, angehende Theologinnen und Theologen bei einer Vorlesung mit dem unscheinbaren Namen »NT-Seminar« darin einzuführen. Am Ende der Vorlesung müssen sie eine wichtige und gefürchtete Prüfung bestehen: eine schriftliche Arbeit von 20 Seiten, in der sie einen ihnen nach dem Zufallsprinzip erteilten neutestamentlichen Text mit einem Umfang von drei bis fünf Versen auslegen müssen. Dabei geht es nicht darum, dass sie zu bestimmten mit meiner Meinung übereinstimmenden Ergebnissen kommen, sondern darum, dass sie ihren Text transparent und nachvollziehbar nach allgemein anerkannten Prinzipien deuten. Drei Prinzipien sind besonders wichtig (und können auch von durchschnittlichen Bibellesern auf den deutschen Text gewinnbringend angewandt werden). Ich formuliere sie wie folgt:
1. Kontext ist der König. Die Bedeutung einzelner Aussagen der Schrift, wie übrigens auch in der Alltagskommunikation, kann nur dem Zusammenhang, in dem sie sich befinden, entnommen werden. Nehmen wir den einfachen Ausruf »Feuer!« als Beispiel. Wenn Sie im Theater sitzen und plötzlich ein Mann die Tür aufreißt und dieses eine Wort schreit, könnte es Ihr Leben retten. Wenn Sie jedoch an einer Mauer mit verbundenen Augen stehen, einer Zigarette im Mund, und sieben Gewehren auf Sie gerichtet, ist das wohl das letzte Wort, das Sie jemals hören werden! Der Kontext macht den Unterschied aus, ob ein einziges Wort lebensrettend oder todbringend wirkt.
Dieses Prinzip ist bei der Auslegung der Bibel überaus wichtig, wird aber sehr oft vernachlässigt. Ich hatte eine liebe alte Tante, die mir zu jedem Geburtstag und jedem wichtigen Feiertag eine Karte schrieb. Eines Jahres erhielt ich zu Ostern eine Karte von ihr, auf der das Abbild eines leeren Grabes mit den Worten »Die Welt wird sich freuen!« in einem vor Freude strotzenden Schriftzug zu sehen war. Dieser Text entstammt jedoch Johannes 16,20, wo es im Kontext darum geht, dass sich die Welt freuen wird, wenn Jesus endlich aus dem Weg geräumt wird, während seine Jünger in Trauer stürzen werden. Der Vers wurde ganz gegen seine ursprüngliche Absicht eingesetzt. Ich fühlte mich nicht genötigt, meine fürsorgliche Tante darüber aufzuklären, nahm mir aber erneut vor, so nicht mit der Bibel umzugehen.
Eine wichtige Implikation einer kontextgemäßen Auslegung wird gerade in Abhandlungen von biblischen Texten zum Thema Sexualität oft ignoriert. Man darf nämlich nicht spekulative Thesen, die keine Basis im Text bzw. im Kontext haben, heranziehen, um Textaussagen der Bibel zu relativieren. Nun kommt man nicht darum herum, über die ursprüngliche Situation, in der unklare Aussagen entstanden sind, Vermutungen anzustellen. Bibelauslegung lebt davon, auf diese Weise für Textinhalte plausible Erklärungen zu finden. Aber diese müssen einen Anhaltspunkt im Text haben und dürfen nicht einfach der Fantasie des Auslegers entspringen. Nur das gewährleistet einen verantwortlichen Umgang mit biblischen Texten.
Das geschieht z.B. häufig, wie wir sehen werden, in der Auseinandersetzung mit Römer 1,26-27, wo gleichgeschlechtlicher sexueller Verkehr thematisiert wird. Manche Ausleger vermuten, dass dabei der Autor (der Apostel Paulus) eine ganz bestimmte Situation vor Augen hatte – einer populären These zufolge die wilden Orgien unter dem Kaiser Caligula. Wenn das stimmen würde, ließe es die Aussage des Textes in einem anderen Licht erscheinen. Diese These klingt vielleicht zunächst plausibel (wenn auch nur auf den ersten Blick – eine nähere Betrachtung lässt große Zweifel an ihrer historischen Wahrscheinlichkeit aufkommen; siehe dazu Abschnitt VIII.2). Nach den Prinzipien der Bibelhermeneutik ist aber eine solche Vorgehensweise unzulässig. Denn nirgends in Römer 1 und auch nicht sonst im Römerbrief gibt es den leisesten Hinweis darauf, dass Paulus an Caligula denkt. Vertrauenserweckende Auslegung biblischer Texte sieht anders aus.
2. Zeitgenössische Wortbedeutung ist die Dame. Es ist wichtig zu beachten, dass einzig und allein die zum Zeitpunkt des Autors vorherrschende Bedeutung eines Wortes für die Auslegung biblischer Texte von Belang ist. Die Herkunft eines Wortes bzw. sein sprachlicher Werdegang ist dafür unerheblich. Es kommt häufig vor, dass sich die Bedeutung eines Wortes im Laufe der Zeit verändert. Darüber gibt die »Etymologie« Auskunft. Sie bietet oft faszinierende Einsichten, die aber für die korrekte Deutung eines Wortes im zeitgenössischen Gebrauch unwichtig sind. Das Wort »Beute« bezeichnete zum Beispiel früher einen Bienenstock. Wer darauf besteht, dass es heutzutage so verstanden werden muss, wird bald merken, dass keiner ihn versteht (außer unter Imkern, bei denen es als Fachbegriff noch geläufig ist). Sagt er einem Gast: »Dieser Honig kommt direkt aus der Beute«, wird er merken, dass sich jener an den Kopf greift. Im Mittelalter war »Waffe« ein anderes Wort für »Schwert«. Inzwischen bezeichnet es alle möglichen Tötungsinstrumente. Wer pedantisch einfordert, dass das Wort nur nach seiner ursprünglichen Bedeutung eingesetzt und deswegen eine Pistole nicht als Waffe bezeichnet werden darf, wird sich daran gewöhnen müssen, dass alle ihn für einen Spinner halten. Bis heute stört es viele ältere Gemeindemitglieder, dass Jugendliche etwa einen Gottesdienst als »geil« beschreiben. Für sie heißt »geil« nur »sexuell stimulierend« und keineswegs »großartig«. Aber selbst sie würden gegebenenfalls sagen, sie fanden den Gottesdienst »toll«, was wiederum ihre Großeltern, für die das Wort »tollwütig« bedeutete, vermutlich gestört hätte.
Bei der Auslegung biblischer Texte muss man sich insbesondere davor hüten, bei einem dort erwähnten Konzept eine Bedeutung hineinzulesen, die im Laufe der Zeit hinzugekommen ist, aber damals nicht geläufig war. Wenn zum Beispiel der Apostel Johannes behauptet, dass »das Blut Jesu uns von aller Sünde reinigt« (1Joh 1,7), darf man nicht, wie es ein gläubiger Arzt einmal tat, auf die reinigende Funktion der Blutbahnen (in Zusammenarbeit mit Leber und Niere) hinweisen. Er erklärte, wie Jesus uns analog dazu »entgiftet«. Das war eine spannende Predigt mit neuen Einsichten, die an sich nicht falsch waren. Dennoch muss dagegen Einspruch erhoben werden. Denn davon wusste in der Antike kein Mensch. Auch nicht Johannes, der folglich etwas anderes – wohl die reinigende Wirkung von Schlachtopfern im alttestamentlichen Kult – gemeint haben muss.
Solche Fehler geschehen oft bei der Auslegung biblischer Texte, die Kenntnisse der damals vorherrschenden sexualethischen Konventionen voraussetzen. Jeder Deutsche weiß zum Beispiel, was »Ehebruch« heißt: Geschlechtsverkehr zwischen zwei Personen, von denen zumindest eine davon mit jemand anderem verheiratet ist. Wir werden aber sehen, dass dieser Begriff im neutestamentlichen Zeitalter mehr umfasste als nur den Geschlechtsakt. Wer sich dessen nicht bewusst ist, läuft Gefahr, die relevanten biblischen Texte unpräzis zu deuten und daraus falsche Schlüsse zu ziehen.
3. Wortwahl ist der Bube. Warum verwendet ein bestimmter Autor ein bestimmtes Wort in einem bestimmten Zusammenhang? Warum sagte die deutsche Fußballlegende Sepp Herberger »Das Runde muss ins Eckige« statt »Der Ball muss ins Tor«? Hier bedarf es keiner langen Analyse – er wollte einer banalen Wahrheit eine lyrische Note verleihen. Manchmal will man Dinge dezent statt deutlich aussprechen: »Sie ist nicht mehr unter uns« klingt schöner als »Sie ist tot«. Manchmal will man die Wahrheit nicht ganz eingestehen: »Schatz, ich hatte einen kleinen Unfall« oder »Es hat nur ein paar Euro gekostet«. Oft will man die Konnotation eines bestimmten Wortes vermeiden – Vertreter der Energiekonzerne bilden eine »Lobby«, während Greenpeace als »Hilfsorganisation« gilt –, obwohl beide das Gleiche tun: Politiker beeinflussen, damit sie ihre Interessen vertreten. Oder man will, je nach Situation, emotionale Distanz oder Nähe verschaffen: Nach dem Wohlergehen eines »Fötus« würde man eine Schwangere, die sich auf ihr Kind freut, nie fragen; umgekehrt vermeiden es Angehörige und Freunde von einem »Baby« zu sprechen, wenn die Schwangere ihr Kind abtreiben will.
Читать дальше