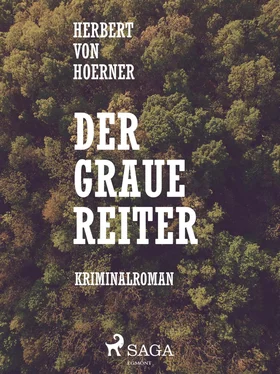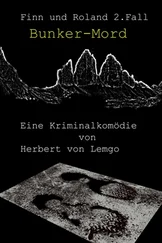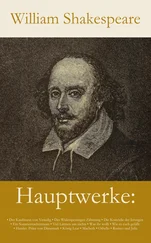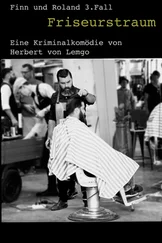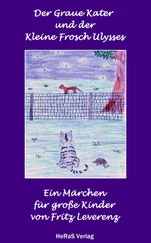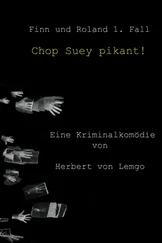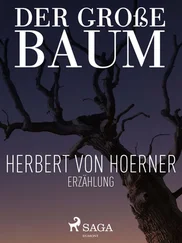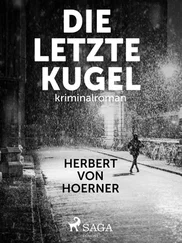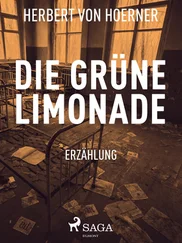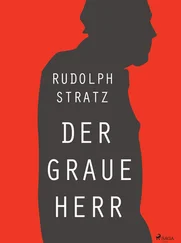Aber das eine, das grösste Bedenken, blieb bei alledem doch noch bestehen: die Kosten! Darum war ja auch an Ziegelbau, Zementguss und dergleichen nicht zu denken. Und wenn nun auch der Feldstein nichts kostete, so kostete doch der Kalk, den man für den Mörtel brauchte. Auch kam man ja bei keinem Bau ohne Holz aus. Was da allein für das Dach draufgehen würde! Eigentlich müsste man es mit Dachpfannen decken, der Schönheit wegen. Aber wer konnte das bezahlen? Stroh? — nein, Stroh sollte es nicht sein, aber Schindeln. Und es gab eine rote Farbe. Wenn man mit der die Holzschindeln strich, sah es von weitem genau so aus wie ein Ziegeldach. Auch sollte die Farbe das Holz vor Fäulnis schützen. Das war eine Lösung. Es musste sich auch für alles andere eine Lösung finden. Ein wenig Eisen, ein wenig Glas, und was sonst noch zum Bauen nötig war — nun, was wirklich nötig war, das musste eben beschafft werden! Hauptsache, dass die Steine nichts kosteten!
Wezrumba freute sich so, als hätte er die Steine schon, die er brauchte. Er trug seine Gedanken schweigend umher. Die Arbeit am Heu liess keine Zeit zu Gesprächen. Aber die anderen merken es, wenn einer im Hause seine Gedanken verbirgt. Die Frau sah zuweilen den Mann prüfend von der Seite an. Sie freute sich über sein frisches, unternehmendes Aussehen. Es kam ihr aber eine kleine Bangigkeit dabei. Sie wusste nicht, woher.
Zu den feststehenden Gewohnheiten des Bauern Wezrumba gehörte natürlicherweise auch die, dass an jedem Tage des Jahres beim Erwachen sein erster Blick und seine erste Frage dem Wetter galten. Dabei begnügte er sich nicht damit, durch die immer ein wenig trüben kleinen Scheiben eines der Fenster zu sehen, sondern er trat vors Haus, um zu spüren, wie und von woher die Luft wehe.
Sein Haus, durch einen Mittelgang geteilt, hatte zwei Ausgänge, den einen nach dem Inneren des Wirtschaftshofes und den anderen nach der Seite des Flusses. Und weil über das Wetter das Nahe nicht so viel zu sagen weiss wie das Ferne, darum trat der Bauer Wezrumba an jedem Morgen zuerst nach der Seite des Flusses hinaus.
Es hätte schon fast genügt, diesen allein zu befragen. Am Glanz des Wassers, ob es trüber erschien oder klarer, am Himmelsabbild auf der durch die Strömung immer bewegten, immer leise fortgleitenden Fläche und am jenseitigen Ufer, an dessen Färbung, Dunkelheit, Deutlichkeit, oder auch Verschwommenheit und Blässe erkannte der Wetterkundige, worauf er sich für den Tag einzurichten hatte. — „Wir müssen uns nach dem Wetter richten und dürfen nicht erwarten, dass das Wetter sich nach uns richten wird“, pflegte Wezrumba zu sagen, wie das schon sein Vater und dessen Vater und wahrscheinlich auch schon Ur-Wezrumba gesagt hatten.
Aber ein Wetteranzeiger besonderer Art war ihm drüben die Ruine. Kein Gegenstand in der Nähe oder Ferne konnte so verschieden gefärbt erscheinen wie sie. Und darüber hinaus war sie ihm auch noch Sonnenuhr und Kalender. Ob auch der Wald, den steilen Hang unter ihr hinaufwachsend, mehr und mehr von ihr verdeckte und sie selber, bröckelnd, sich verringerte, so ragte doch noch genug von ihr über die Spitzen der Bäume vor, woran, zumal am Nachmittage, am Schatten von Turm und Wand genau die Stunde des Tages abzulesen war und, was sie noch bedeutender machte, bei Sonnenaufgang der Tag des Jahres.
Zweimal im Jahr ging die Sonne, von Wezrumbas Hause aus beobachtet, genau hinter der Ruine auf. War es in der steigenden Hälfte des Jahres, so schlug danach das grosse Pendel von Tag zu Tag ein Stückchen weiter nach links hin aus, bis an einer bestimmten Uferstelle der Wendepunkt erreicht war, von dem aus der Sonnenaufgang nun wieder zurückwanderte, das zweite Mal, nun in der sinkenden Hälfte, die Ruine berührte, um sich sodann nach rechts und immer weiter nach rechts von ihr zu entfernen, über den Oberlauf des Flusses bis auf die Seite des Bauern, bis auch hier wieder an einem bestimmten Punkt über dem Walde des Staats die Umkehr geschah, wonach der Sonnenaufgang sich wieder der Ruine zu nähern begann. Und eben daran, an Stellung und Abstand der aufgehenden Sonne zur Ruine, liess es sich untrüglich ablesen, bis zu welchem Tage spätestens im Frühjahr der Hafer gesät sein musste, wie ebenso auch der Roggen im Herbst, und auch, wann es Zeit war, ans Heu zu denken und gleicherweise an die Kartoffeln.
Das war es, wodurch die Ruine, ob sie auch sonst zu nichts mehr zu brauchen war, für den Bauern Wezrumba immer noch als ein nützlicher Gegenstand ihre besondere, nicht geringe Bedeutung hatte. Aber nicht darum allein war er ihr wohlgesinnt und blickte gern zu ihr hinüber. Die Ruine war ihm das, wovon jeder Mensch sein bestimmtes Teil braucht: ein gewohnter Anblick. Er kannte sie so lange wie sich selbst, und das allein schafft ja schon immer eine gewisse Verbindung.
Aber schon eine lange Zeit war’s, dass er nicht mehr droben bei ihr gewesen war. Als kleiner Junge, während der Vater unten am Fluss angelte, war er wohl etliche Male hinaufgelaufen, um sich das alte Gemäner anzusehen und daran herumzuklettern. Er hatte auch einmal dagestanden und auf etwas gewartet, das nicht kam. Und nachher, als grosser Junge, fast schon Mann, er mochte etwa in Ansis Alter gewesen sein, hatte er einen ganzen müssigen Tag dort oben zugebracht, mit nichts beschäftigt als mit dem grossen Staunen, wie es ja zumeilen die Jugend hat über sich und die Welt. Er war von innen an der Wand emporgeklettert. Wozu hatte er das getan? Bloss um durch eine der leeren Fensteröffnungen zu gucken. Er hätte dabei abstürzen und sich das Genick brechen können. — Wie ja so die Jugend allerlei Unnützes tut, aus Übermut, aus Waghalsigkeit und weil sie nicht weiss, wohin mit ihren Kräften. Aber seitdem war er nun nicht mehr oben gewesen. Als Bauernsohn, zumal als Ältester, der früh den Vater verlor, hatte er anderes zu tun gehabt als merkwürdige Gegenden aufzusuchen und sich die Welt durch ein Burgfenster zu betrachten.
So kannte also Wezrumba die Ruine, obwohl nur durch den Fluss von ihr getrennt, die meiste Zeit seines Lebens nur von ferne, eben als den gewohnten Anblick, der ihm nur dann entzogen war, wenn der Nebel, wie es nicht selten vorkam, so dick über dem Fluss lag, dass man das andere Ufer nicht sah. Dann war natürlich auch die Ruine nicht zu sehen.
Sewohnte Anblicke sollten sich tunlichst überhaupt nicht ändern. Wer aber genauer hinsieht, merkt mit der Zeit an allem eine Veränderung, sogar an den Sternen. Wezrumba hätte nicht genau anzugeben gewusst, in welchem Jahre seines Lebens jenes Stück von der Mauer weggebrochen war, das von ihren vormaligen vier Fenstern nur noch drei übrig liess. Vielleicht hatte er damals gerade mehr in die Augen des Mädchens Anne als in die der Ruine geguckt. Es kann ja im Leben mal das eine und mal das andere das Wichtigere sein. Jedenfalls liess sich feststellen, dass während der zweiundvierzig Jahre seines Lebens der gewohnte Anblick nicht unverändert geblieben war.
Aber ändern können sich nicht nur die Gegenstände, auch der Blick, mit dem der Mensch sie betrachtet, kann anders werden. Wezrumba sah, seit er den Gedanken mit den Steinen gefasst hatte, die Ruine mit anderen Augen an als zuvor. Frau Anne merkte das, aber sie fragte nicht. Sie wunderte sich, da sie eines Morgens früh den Mann damit beschäftigt fand, das Boot — es hatte in der Nacht geregnet — auszuschöpfen.
Er liess sich von Ansis die Ruder bringen. Was wollte er? Angeln? Dazu war doch wohl jetzt, da die Ernte des Korns nahe bevorstand, nicht die Zeit. Auch war nicht zu bemerken, dass er irgendein Fischgerät mitgenommen hätte. Aber vielleicht steckten drüben Setzangeln, die er nachsehen wollte. Weder sie noch Ansis taten eine Frage. Sie sah dem Mann kopfschüttelnd nach, wie er davonruderte. Ansis ging an die Arbeit, die ihm aufgetragen war.
„Seit dem Wirbelwinde ist er anders“, dachte die Bäuerin. „Und ich bin auch anders. Wenn nur beides gut wird!“
Читать дальше