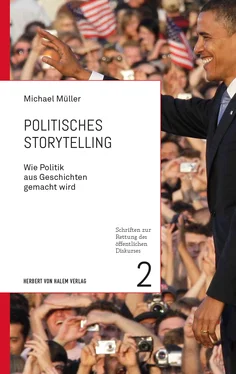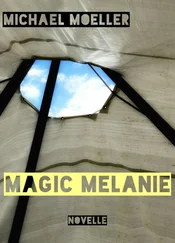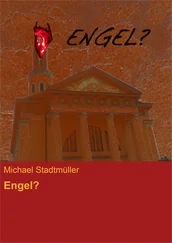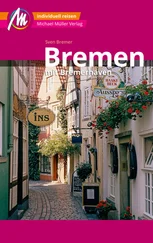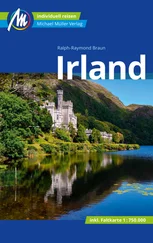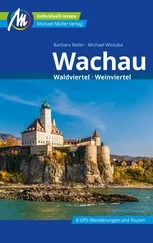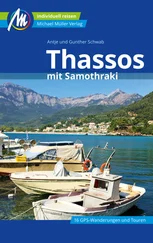Michael Müller - Politisches Storytelling
Здесь есть возможность читать онлайн «Michael Müller - Politisches Storytelling» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Politisches Storytelling
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Politisches Storytelling: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Politisches Storytelling»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Politisches Storytelling — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Politisches Storytelling», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Nichts liegt mir ferner, als anti-aufklärerisch zu argumentieren. Die Entdeckung der Vernunft im 18. Jahrhundert und der Versuch, viele Lebensbereiche (auch) rational zu verhandeln, inklusive der Entstehung der modernen Wissenschaft, ist unschätzbar. Aber wir – die westliche Kultur – waren so froh über die Entdeckung der Vernunft, dass wir sie eben maßlos überschätzten. Nicht nur, aber auch und vor allem sichtbar wird diese Überschätzung in der Politik. Als in Deutschland ab 2015 rechtspopulistische Strömungen immer stärker wurden, war die Verwunderung vieler Politiker und Journalisten über die Tatsache groß, dass Anhänger von Bewegungen wie ›Pegida‹ und Parteien wie der AFD ganz offenbar Argumenten nicht zugänglich waren: Wenn man einem Pegida-Anhänger in Dresden vorrechnete, dass in seiner Stadt nur sehr wenige islamische Ausländer lebten, dort also von einer ›Islamisierung des Abendlandes‹ keine Rede sein konnte, führte dieses Argument in der Regel zu keinerlei Einsicht; die Islamisierung komme schon noch, in anderen Teilen Deutschlands sei sie schon viel weiter etc. In einer Dokumentation der Panorama-Redaktion des ZDF kann man diese ›Vernunft-Verweigerung‹ anschaulich miterleben. 3Das ist wie in dem alten Witz: Vier Männer sitzen am Stammtisch, trinken, schweigen. Nach längerer Zeit sagt der Erste: »Was stinkt denn da so?« Schweigen. Dann sagt der Zweite: »Das sind die Hunde.« Wieder Schweigen. Der Dritte schaut unter den Tisch: »Sind gar keine da!«. Wieder Stille, worauf der Vierte sagt: »Die werden schon noch kommen!«
Wenn man davon überzeugt ist, in einer Welt zu leben, in der Argumente und Fakten regieren, bleibt einem vieles unerklärlich. »Jetzt habe ich es schon tausend Mal erklärt, aber die kapieren es immer noch nicht!« Diesen Stoßseufzer vieler Lehrer kennen wohl auch zumindest diejenigen Politiker sehr gut, die an der Basis und ›vor Ort‹ unterwegs sind. Und sowohl die Lehrer als auch die Politiker (und auch viele Journalisten) erklären es dann noch einmal, und noch einmal, und versuchen immer wieder, mit Argumenten ihre Gegenüber von der Unvernunft ihrer Haltung zu überzeugen. ›Immer mehr vom Gleichen‹ heißt diese Strategie, die eine der erfolglosesten überhaupt ist und nur von jemandem gewählt werden kann, dessen Weltsicht keinen Ausweg erlaubt: Entweder man überzeugt rein rational oder gar nicht. Die tiefsitzende Überzeugung, dass ernstzunehmende Politik mit Vernunft und Argumenten gemacht werde, verhindert die Suche nach anderen Lösungen. Denn vielleicht könnte man es ja einmal mit einem neuen Narrativ oder mit einer Geschichte probieren?
Doch wie oben schon angeklungen ist, hat das Erzählen einen zweifelhaften Ruf. Oder besser gesagt: zweierlei Ruf. In Literatur und Film ist »Storytelling« zurzeit eher gut angesehen, nach den großen Zweifeln zwischen den 1970er- und den 1990er-Jahren, in denen im Literaturdiskurs oft sogar ein ›Ende des Erzählens‹ ausgerufen wurde. Die meisten jüngeren Romanautoren würden sich heute ohne große Hemmungen als Erzähler bezeichnen, während andere – wie zum Beispiel Lukas Bärfuss, dessen Ausruf »Hört auf mit euren Geschichten!« Jonas Lüscher kritisch in seinen Poetikvorlesungen zitiert (LÜSCHER 2020: 18) – immer noch ein gutes Stück Skepsis gegen das Erzählen kultivieren. Im Journalismus hat der Ruf des Erzählens, der auch hier in den letzten 10 bis 20 Jahren in Blüte stand, mit dem erwähnten Relotius-Sandal im Dezember 2018 einen Dämpfer erhalten. In Marketing und PR erlebt das Storytelling einen Boom, in den sich jedoch auch kritische Stimmen mischen: Wenn alle auf Teufel komm raus ihre Geschichten erzählen, ist Storytelling dann noch geeignet, einen Unterschied im Krieg um die Aufmerksamkeit zu machen? Über diese Formen eines reinen ›Storytelling‹ hinaus werden narrative Ansätze in der Medizin, in Psychotherapie und Coaching, in der Ökonomie, in der Organisationstheorie, in der gesellschaftlichen und politischen Diskursanalyse entdeckt. Die Aufmerksamkeit für das Erzählen, die Geschichten und die Narrative und was man damit alles machen kann, ist also in den letzten Jahren stark gestiegen – mit positiven wie negativen Ausprägungen. Die positiven Annahmen zum Erzählen berufen sich, wie erwähnt, auf neuere Erkenntnisse von Hirnforschung und narrativer Psychologie, die negativen neben dem ebenfalls erwähnten Überdruss vor der Ubiquität der ›Buzzwords‹ vor allem auf den Verdacht, Geschichten seien manipulativ, bzw. mit Geschichten könne man besonders gut manipulieren. Gerade an diesem Manipulationsverdacht machen sich wohl vor allem auch die Bewertungen von ›Storytelling‹ im politischen Raum fest: Einerseits das Unbehagen, sich des Verdachts der Manipulation ausgesetzt zu sehen, andererseits jedoch auch die Einsicht in die Notwendigkeit der Manipulation – wenn man diesen Begriff einmal als wertfrei betrachtet, als ein Mittel, Realitätskonzepte so zu konstruieren, dass sie Menschen anspricht. Ich werde in diesem Buch auch darauf eingehen, was ›Manipulation‹ im Zusammenhang mit dem Erzählen bedeuten kann. Nur soviel vorab: Die Vorstellung von einer Kommunikation, die absichtslos nur von ›Wahrheiten‹ handelt, ist pure Fiktion. Es gibt keine kontextlose Wahrheit, Annahmen über die Realität sind immer die einer bestimmten Person, einer bestimmten Gruppe. Eine Geschichte zu erzählen bedeutet daher immer, sie aus einer bestimmten Perspektive zu erzählen. Wenn mir das als Rezipient bewusst ist, habe ich Distanz zwischen die Geschichte und mich gelegt und bin weniger manipulierbar (wenn man Manipulation einmal so versteht, dass jemand unbemerkt zu einem Handeln gebracht wird, das er von sich aus so nicht ausführen würde).
Geschichten, Storys, Narrative – ich werde auf die unterschiedlichen Bedeutungen dieser Begriffe noch eingehen –, sind ein wesentlicher, unverzichtbarer Bestandteil menschlicher Gesellschaften, und zwar jeder menschlichen Gesellschaft, ob in der Antike oder heute – auch wenn es uns oft so vorkommt, als ob erst unsere ›Mediengesellschaft‹ nach Geschichten verrückt sei. Natürlich wurde immer erzählt: Klischeehaft denken wir an die Lagerfeuer der Höhlenbewohner oder an die bäuerlichen Kachelöfen an langen Winterabenden. Über dieses unterhaltende oder belehrende Erzählen hinaus bilden aber Geschichten, narrative Strukturen, auch eine wesentliche Klammer, die Gesellschaften, Gruppen, Völker oder Kulturen zusammenhalten. Mythische oder religiöse Erzählungen über die Entstehung der Welt, der eigenen Gruppe oder der Regeln, nach denen wir leben, definieren Gesellschaften oder Gruppen: Woher kommen ›wir, die Griechen‹ (im Gegensatz zu den Barbaren) warum sind wir das auserwählte Volk, wie eint uns der Glaube an einen Gott und die Geschichten, die sich um ihn ranken, oder wie entstand die Demokratie und mit der Aufklärung das Wertesystem, dem wir uns als kultureller ›Westen‹ verpflichtet fühlen? All dies beruht auf Geschichten, Erzählungen, Narrativen, die eine Gruppe oder Gesellschaft teilt und über die sie sich definiert. Dabei gibt es eher inkludierende narrative Systeme, die relativ offen sind für Menschen, die Teil davon werden wollen, und eher exkludierende, die eine starke Grenze etablieren und damit die meisten Menschen ausschließen. Das klassische Narrativ der USA als Einwanderungsland, in dem jeder sein Glück suchen kann, ist ein inkludierendes, das Trump in ein exkludierendes zu verwandeln sucht. Viele Religionen sind einerseits inkludierende Story-Welten, wenn es um die Missionierung ›heidnischer‹ Völker geht, und zugleich exkludierende, wenn es gilt, Häretiker, Abweichler, Regelbrecher im Inneren auszuschließen (historisch häufig final). Und es gibt eher offene gesellschafts-konstituierende Story-Welten und eher geschlossene. Offene narrative Systeme sind solche, die nur wenige Basis-Narrative oder Geschichten voraussetzen, um Gemeinsamkeit zu schaffen und ansonsten ganze Bündel inkludierender Sinn-Narrative zulassen, solange sie nur mit dem Basis-Narrativ kompatibel sind. Geschlossene Story-Welten dagegen sind solche, die den Glauben oder zumindest die Akzeptanz eines ganz genau festgelegten Geschichten-Systems voraussetzen, um Zugehörigkeit zu definieren. Das ›christliche Abendland‹ des Mittelalters war ganz klar ein geschlossenes narratives System (man musste genau die Geschichten (und ›Wahrheiten‹), die in der Bibel standen, für zutreffend (oder tatsächlich geschehen) halten, und zwar alle, und nur sie. Unsere Gesellschaft ist eher offen, ›offiziell‹ gibt es nur wenige grundlegende Werte, Auffassungen und Narrative, deren Akzeptanz tatsächlich vorausgesetzt wird, etwa die Menschenrechte, das Grundgesetz und die Tradition eines aufklärerischen Liberalismus (ich meine hier explizit nicht den Wirtschaftsliberalismus!). Von konservativer und vor allem von rechtspopulistischer Seite wird in den letzten Jahren verstärkt diskutiert, wie offen wir eigentlich sein wollen: Fragen wie die, ob der Islam zu Deutschland gehört, schließen potenziell nicht nur Menschen islamischen Glaubens aus, sondern implizieren – in der Aktivierung des alten europäischen Narrativs vom Kampf des Islam gegen das Christentum –, dass das Christentum dagegen zu Deutschland gehört, und letztlich eine Inklusionsvoraussetzung ist. Auch Begriffe wie die des »Biodeutschen« (Biofranzosen, Biopolens, etc.) implizieren, dass Dazugehören über ein historisches Narrativ der Abstammung definiert sei. Dies ist übrigens ein besonders exkludierendes Narrativ, da es für nicht Dazugehörende niemals einholbar ist: Eine deutsche Abstammungsreihe kann ich, anders als eine Religionszugehörigkeit, als Neubürger niemals erreichen.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Politisches Storytelling»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Politisches Storytelling» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Politisches Storytelling» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.