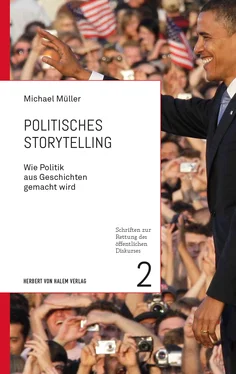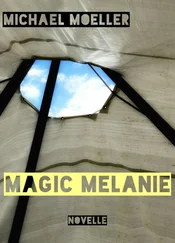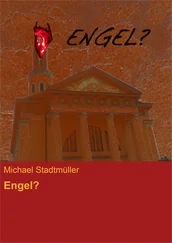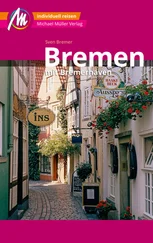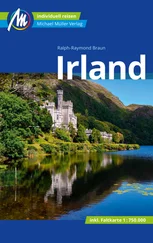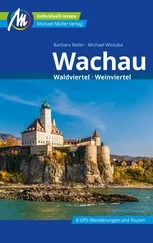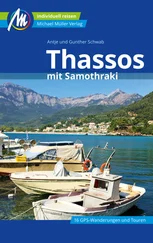Michael Müller - Politisches Storytelling
Здесь есть возможность читать онлайн «Michael Müller - Politisches Storytelling» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Politisches Storytelling
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Politisches Storytelling: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Politisches Storytelling»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Politisches Storytelling — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Politisches Storytelling», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Über diesen einfachen Überdruss hinaus gibt es in unserer Kultur aber auch ein tiefer sitzendes Misstrauen gegen das Erzählen. Wieder einmal deutlich wurde dies im Dezember 2018 im Zuge des Relotius-Skandals. Dabei wurde aufgedeckt, dass Claas Relotius, ein mit Preisen überhäufter junger Reporter, der unter anderem für den Spiegel schrieb, sehr viele seiner Reportagen in Details oder zur Gänze gefälscht hatte. In die Aufarbeitung dieses Skandals mischten sich auch Stimmen, die dem Erzählen – für das Genre der Reportage ja fundamental – eine Mitschuld an den Fälschungen gab. So schrieb etwa die taz : »An Journalistenschulen lernt der Nachwuchs, dass Reportagen beim Leser ›Kino im Kopf‹ erzeugen sollen, dass ein guter Text starke ›Protagonisten‹ braucht und einen ›Konflikt‹, dass die ›Dramaturgie‹ des Textes wichtig ist. Man lernt, die Texte nicht Artikel zu nennen, sondern ›Geschichten‹. Journalistenschüler belegen ›Storytelling‹-Seminare, als schrieben sie für Netflix.« 1Ähnlich kritische Haltungen gegenüber einer zu starken Betonung des Erzählerischen im Journalismus wurde in vielen Medien geäußert; die Storytelling-Beraterin Petra Sammer hat auf der Online-Plattform LinkedIn eine kritische Zusammenfassung dieser Stimmen geschrieben. 2
In bestimmten Kontexten – etwa im Journalismus oder auch in der Politik – ist offenbar das Geschichtenerzählen in Verruf geraten. Hinter vielen Reaktionen auf den Relotius-Skandal steht implizit die Forderung, das Erzählen solle zurückkehren zu den ihm angestammten Bereichen der Literatur, des Films und anderer Fiktionen, und es sei aus Bereichen, die es mit ›Wahrheit‹ und Argumenten zu tun haben, zu verbannen. Zu gefährlich scheint das Erzählen als eine Form, in der sich Wahrheit und Fiktion auf undurchschaubare Weise mischen und die einen dramaturgischen Schleier vor die argumentative Auseinandersetzung mit der Realität hängt. Der angestammte Bereich des Erzählens, so legen diese Haltungen nahe, sei die Unterhaltung im weitesten Sinne: Film, Roman, Kunst, etc. Wenn es ernst wird – in der Politik, in der Wirtschaft – habe das Erzählen allenfalls als ausschmückender Schnörkel seine Rechte, aber sonst gehe es eben um harte Fakten und sachliche Argumente.
Doch ganz so einfach ist es mit dem Erzählen nicht. Narrative Strukturen liegen sehr vielen Diskursen zugrunde, Narrative stecken, sichtbar oder verborgen, in zahlreichen Kommunikationen im Alltag und in den Medien. Narrative Strukturen bestimmen unser Denken sehr viel stärker, als die meisten von uns ahnen. Wir sind in gewisser Weise tatsächlich »Storytelling Animals « , wie es der amerikanische Autor Jonathan Gottschall behauptet (GOTTSCHALL 2012). Die narrative Psychologie, eine in den 1980er-Jahren entstandene, ständig an Gewicht gewinnende Forschungsrichtung, beschäftigt sich mit dieser fundamentalen Bedeutung, die Geschichten und narrative Strukturen für uns Menschen haben (vgl. z.B. BRUNER 1986; SARBIN 1986; LÁSZLÓ 2008), in den letzten beiden Jahrzehnten sekundiert von der Gehirnforschung (z.B. ROTH 2003). Die Art und Weise, wie wir Kausalitäten herstellen, Erlebnissen und Ereignissen einen Bedeutungsrahmen und damit Sinn geben, ist die der narrativen Strukturen, Geschichten, Erzählungen. Allein schon deshalb kann sich Politik nicht darum drücken, sich mit Storytelling zu beschäftigen. Und Storytelling zu betreiben, wenn sie die Menschen wirklich erreichen will.
Aber was bedeutet ›Storytelling‹ im politischen Bereich? Sieht man sich, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, einmal an, wie der Begriff ›politisches Storytelling‹ in Alltag und Medien verwendet wird, kristallisieren sich folgende drei Bedeutungen heraus:
•Politisches Storytelling als ein rein unterhaltendes Element, um damit Reden mit Anekdoten und launigen Schnurren zu würzen und unterhaltsamer zu machen. Politisches Überzeugen aber, so die Perspektive dieser Haltung, geschehe ›natürlich‹ immer noch mit Argumenten.
•Politisches Storytelling als ein rhetorisches Stilmittel, mit dessen Hilfe politische Programme und Argumente besser an die Frau / den Mann gebracht werden können. Diese Bedeutung ist, dank der Popularisierung des »Buzzwords« Storytelling, zurzeit die wohl am meisten verbreitete: Politiker, die von der Kraft des Erzählens gehört haben, hoffen, es genüge eine gute Geschichte, um Menschen dazu zu bringen, auf den Wahlzetteln das Kreuz an der richtigen Stelle zu machen. »Narration als Gleitmittel für trockene Zahlen«, wie es der Schriftsteller und Philosoph Jonas Lüscher ausdrückt (LÜSCHER 2020: 66).
•Politisches Storytelling als strategische Maßnahme, bei der ein bestimmter Strauß von Geschichten oder Geschichten-Formen geschnürt wird, der eine politische Haltung ausdrücken soll. In diesem Sinn wird der Begriff nicht selten von Agenturen verwendet, die Politiker oder Parteien im Wahlkampf unterstützen.
Natürlich drücken all diese Bedeutungen Qualitäten von Geschichten und Erzählen aus. Und doch greifen sie, isoliert betrachtet, zu kurz: Wer glaubt, es genüge, politische Argumente in eine schöne Geschichte zu verpacken, um die Herzen und Hirne der Menschen zu erreichen, wird schnell frustriert sein. Denn das Erzählen als Weise der Welt- und Sinnerzeugung steht in vielerlei Interdependenzen und Zusammenhängen, die es zu berücksichtigen gilt. Und dazu kommt natürlich, wie an der Diskussion der Relotius-Affäre deutlich wurde, auch noch eine ethische Komponente, ohne die schnell ›Fake Storys‹ oder stark manipulative Geschichten Terrain gewinnen.
Neben diesen gängigen Begriffen von Storytelling will sich dieses Buch jedoch mit weiteren Formen des politischen Storytelling, oder besser gesagt, mit der narrativen Ebene in der Politik beschäftigen, eben weil die gängigen Begriffe zu kurz greifen. Politische Geschichten funktionieren nämlich dann gut, wenn sie Narrative benutzen, die in der Gesellschaft entweder seit langem verwurzelt oder gerade im Trend sind. Ein Beispiel: Die antiislamischen Geschichten der Rechtspopulisten finden auch deshalb viel Anklang, weil sie an das alte europäische Trauma-Narrativ ›Die Türken vor Wien‹ anspielen. Und die Grünen stehen jetzt, da ich dies im Frühjahr 2020 schreibe, auch deshalb relativ hoch in der Wählergunst, weil sie – zumindest bis zur Corona-Krise – vom Trendnarrativ ›Fridays for Future / Klimaschutz‹ profitieren. Das heißt, es kommt nicht nur darauf an, welche Geschichten man als Politiker oder als Partei erzählt, sondern vor allem auch darauf, wie resonant die eigenen Geschichten – und die anderen Inhalte, die man kommuniziert, – in der Gesellschaft sind. Und um diesen Resonanzboden oder Humus kennenzulernen, muss man Zuhören lernen. Die drei oben genannten Begriffe von ›politischem Storytelling‹ greifen nämlich auch deshalb zu kurz, weil sie nur auf das ›Telling‹ starren. Das ›Listening‹ ist die zweite, wichtigere Seite der Medaille: Wer erfolgreich mit Geschichten und Narrativen in politischen und gesellschaftlichen Kontexten arbeiten will, muss sich die Zeit nehmen, den Geschichten und Narrativen zuzuhören, die in unserer Gesellschaft von Gruppen und Indivduen erzählt werden.
Die meisten Politiker glauben an Argumente und Fakten. Sie denken in guter aufklärerischer Tradition, dass man Menschen überzeugen kann, indem man ihnen die besseren Fakten präsentiert und auf deren Basis gut argumentiert. Das mag in Einzelfällen auch klappen, aber nicht in der Masse. Seit der Aufklärung im 18. Jahrhundert haben wir uns angewöhnt, unsere Vernunft heillos zu überschätzen. Wir haben seit Adam Smith immer wieder versucht, zu glauben, dass unsere Märkte und damit unsere gesamte Ökonomie über den rationalen Austausch von Informationen funktioniert, auch wenn die Wirklichkeit Gegenbeispiele am laufenden Band liefert: von der Tulpenspekulation in den Niederlanden des 17. Jahrhunderts bis zur Bankenkrise 2008, wo eher Emotionen und Affekte – Angst, Gier, Selbstüberschätzung – das Zepter führten, und nicht die Vernunft. Die Protagonisten dieser Beispiele verhielten sich eben nicht ›vernünftig‹ im klassischen Sinn, sondern agierten und agieren innerhalb bestimmter Narrative, etwa dem Narrativ vom unendlichen Wachstum, dem Narrrativ der eigenen Grandiosität (›Masters of the Universe‹), dem Narrativ der Belohnung von Leistung (Meritokratie-Mythos) etc. Auch in der Politik erreichen Argumente vielleicht einzelne Menschen – aber große Massen erreicht man mit Narrativen und Geschichten, die auf Resonanz stoßen. Übrigens liegt dahinter keine Unterscheidung nach Bildungsgraden, getreu dem Motto: Die tumbe Masse weiß es nicht besser, aber die Gebildeten erreicht man mit Argumenten. Wir Menschen sind ›Storytelling Animals‹ und wir denken in weiten Bereichen in narrativen Strukturen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass auch diejenigen, die Argumente verstehen und akzeptieren, dies im Wesentlichen tun, weil diese Argumente ein bevorzugtes Narrativ, eine Lieblingsgeschichte füttern. Wer grundsätzlich eher rückwärtsgewandten Narrativen anhängt (früher war alles besser), dem werden Argumente und Fakten, die zu belegen scheinen, dass Computernutzung Menschen dumm macht, eher einleuchten als Menschen, die einem technikoptimistischen Zukunfts-Narrativ glauben. Und Menschen, deren zentrales Narrativ ein umwelt-apokalyptisches Untergangsszenario ist, werden Fakten und Zahlen, die das Fortschreiten der Umweltzerstörung belegen, eher glauben als Argumenten, warum die Umwelt in Wahrheit gar nicht bedroht sei. Und umgekehrt. Das heißt: Mit Fakten und Argumenten erreicht man in der Regel diejenigen, die sich davon erreichen lassen wollen (oder können; denn manche Narrative sind auch Gefängnisse, in die man heillos verstrickt sein kann).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Politisches Storytelling»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Politisches Storytelling» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Politisches Storytelling» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.