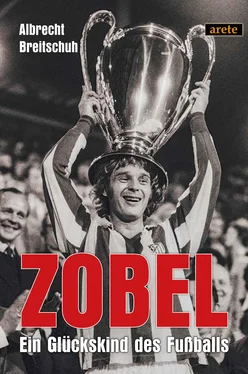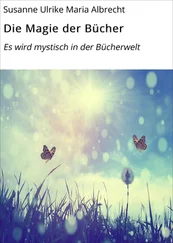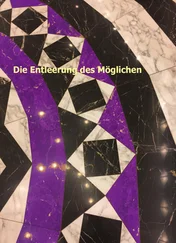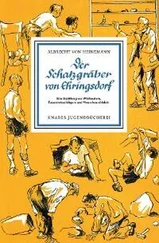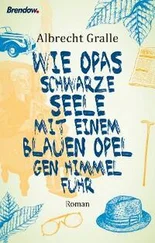„Wir machen erst Halt, wenn wir den ersten englischen oder amerikanischen Soldaten sehen“, hatte sein Onkel die grobe Richtung vorgegeben. Die paar Sachen, die sie bei sich hatten, waren in einem Handwagen verstaut. Im Puppenwagen der Schwester lag Proviant für eine Reise, von der niemand wusste, wie lange sie dauern und wo sie enden würde. Große Teile der Strecke legten sie zu Fuß zurück, ab und zu wurden sie von einem Pferdefuhrwerk mitgenommen oder ergatterten mit viel Glück einen Platz in den wenigen und hoffnungslos überfüllten Zügen, die noch unterwegs waren.
Mit dem Zug erreichten sie im Februar 1945 Uelzen, ohne dort allerdings in Sicherheit zu sein. Im Schritttempo waren sie in den Bahnhof eingefahren, als britische Kampfbomber ihre Fracht abwarfen. Uelzen war als Eisenbahnknotenpunkt ein strategisch wichtiges Ziel der Alliierten, hier wurden landwirtschaftliche Güter, aber auch Vieh verladen und damit die Versorgung großer Teile der Bevölkerung sichergestellt. Ilse Zobel erzählte ihrem Sohn später oft, wie verwundert sie darüber war, als sie nach dem Bombenangriff völlig verängstigt aus dem Fenster schaute und registrierte, dass der Zug den Bahnhof längst verlassen hatte. Sie befanden sich mindestens zehn Kilometer außerhalb Uelzens auf freiem Feld, von der Stadt war nichts zu sehen. Um ihr Leben und das ihrer Familie zitternd, hatte sie überhaupt nicht mitbekommen, dass der Zug wieder ganz langsam losgefahren war.
Wenige Kilometer weiter, im niedersächsischen Wendland, endete die Flucht. Eine dünn besiedelte Gegend mit fremd klingenden Namen: Waddeweitz, Reddebeitz oder Salderatzen hießen die winzigen Dörfer. In ein paar Jahren würde man vom Zonenrandgebiet sprechen. Hier kamen sie erst einmal unter, bis der Großvater eines Tages hörte, dass in der Gemeinde Wrestedt in der Lüneburger Heide dringend ein Schuster gesucht wurde. Der Ort lag zwar 30 Kilometer entfernt und war nicht einfach zu erreichen, aber die Chance auf Arbeit wollte er sich nicht entgehen lassen. Friedrich Retzlaff machte sich auf den Weg und überzeugte den Bürgermeister davon, genau der richtige Mann für diese Stelle zu sein. Obwohl er nun für sich und seine Familie sorgen konnte, niemandem auf der Tasche lag und seinen erlernten Beruf wieder ausübte, blieb die Distanz zu den Einheimischen.
Der Landkreis war zu dieser Zeit voller Flüchtlinge, im Notaufnahmelager am Bohldamm in Uelzen wurden im Schnitt 6.000 pro Tag registriert und anschließend in alle Richtungen verteilt. Nicht wenige blieben aber auch, die Bevölkerungszahl war im Vergleich zur Vorkriegszeit um 80 Prozent gestiegen. Das sorgte für Spannungen. Flüchtlingsvertreter beschwerten sich über schlechte Behandlung oder darüber, dass die Arbeitslosigkeit unter Flüchtlingen besonders hoch war und sie Tätigkeiten verrichten mussten, die nicht im Mindesten ihren oft deutlich höheren Qualifikationen entsprachen. Es dauerte Jahre, bis sich die Lage im Landkreis Uelzen wieder halbwegs entspannte.
Auch dem kleinen Rainer blieb die Erfahrung nicht erspart, dass es aus der Herkunft seiner Familie kein Entkommen gab. Seine Großeltern waren in Wrestedt bei einem Bauern einquartiert worden. Für einen bewegungsfreudigen und abenteuerlustigen Jungen die perfekte Umgebung, aber so sehr es ihn auch zu seinen Großeltern zog, ganz ungetrübt war die Vorfreude auf die Besuche nicht. Das lag an Pohlmann, dem Schwiegervater des Bauern. Ein griesgrämiger alter Mann, der seine noch verbliebene Lebensfreude daraus zog, auf die strikte Einhaltung der Hausordnung zu achten. Vor allem bei den Ruhezeiten duldete er keinen Verstoß. Wenn Rainer die Treppe runter rannte, wartete dort bereits Pohlmann und schnauzte ihn an: „Zu laut!“ Eines Tages stand er wieder am Treppenaufgang. Diesmal verpasste Pohlmann dem Jungen ohne Vorwarnung eine saftige Ohrfeige, verbunden mit der Bemerkung: „Flüchtlingskind!“ Rainer wusste sofort, was da alles mitschwang, dass es nicht nur die Ohrfeige war, die ihm Schmerzen bereitete. Er behielt diese Demütigung zunächst für sich. Als Pohlmann jedoch dazu überging, ihm gewohnheitsmäßig eine zu knallen, öffnete Rainer sich seinem Vater.
Otto Zobel war ein typischer Vater der 50er Jahre. Streng bis autoritär, was er sagte, galt. Kein Freund großer Worte oder Erzählungen. Für die emotionale Versorgung zu Hause war die Mutter zuständig. Oft hatte Rainer versucht, ihm etwas über seine Kriegserlebnisse zu entlocken, aber er kam nicht an ihn heran. Kein Vater, dem man sich als Sohn wie selbstverständlich anvertraute, aber wer hatte solche Väter schon? Die seiner Freunde waren ähnlich. Wahrscheinlich glaubte Otto Zobel sogar, ein liebevoller Vater zu sein, denn dass er das Beste für seine Kinder wollte, stand für ihn außer Frage. Und Rainer konnte sich auf ihn verlassen, wenn es ernst wurde und er mal wieder irgendwelchen Blödsinn verzapft hatte oder es in der Schule Schwierigkeiten gab. Er ließ seine Kinder nicht hängen, wollte, dass aus ihnen mal etwas Anständiges wird. Eine gute Schulausbildung war ihm wichtig, möglichst Abitur, und dann einen Beruf, der auch etwas hermachte. Es reichte, dass mit ihm einer in der Familie die Ochsentour wählen musste, um vorwärtszukommen. Und mit diesen Zielen vertrug sich eine Erziehung der harten Hand durchaus. Wenn diese harte Hand aber gelegentlich Ohrfeigen verteilen musste, sollte es seine sein. Nur seine.
Otto Zobel hörte sich an, was sein Sohn über Pohlmann zu sagen hatte, und ging dann mit ihm zur Polizei, um Anzeige zu erstatten. Die Sache wurde auf dem kleinen Dienstweg geregelt, wie man es auf dem Land eben handhabt, wo jeder jeden kennt. Der Dorfpolizist erschien auf dem Hof und ermahnte Pohlmann zu zivileren Umgangsformen. Danach ließ er Rainer in Ruhe.
In Uelzen gab es keine Pohlmanns, jedenfalls zeigten sie sich Rainer nicht. Die Stadt hatte über 30.000 Einwohner und war groß genug, um als Neuankömmling nicht sofort aufzufallen. Schon gar nicht in der Kasernenstraße, wo die Zobels wohnten. Dort glich ein Haus dem anderen. Das seiner Eltern lag in einem langen Block etwa in der Mitte. Ein schmales Haus, mit einer Grundfläche von kaum mehr als 30 Quadratmetern, zwei Stockwerke hoch. Unten waren Küche und Wohnzimmer, darüber Bad und Elternschlafzimmer, in dem auch Rainers Bett und das seiner jüngeren Schwester Dagmar standen, sowie das einzige Kinderzimmer. In dem schlief die ältere Schwester, aber Rainer stand auf Platz eins der Warteliste, und als Karla mit gerade einmal 19 Jahren als junge, verheiratete Frau die elterliche Wohnung verließ, rückte der zehnjährige Bruder nach. Das Haus hatte noch einen Kohlenkeller und ein Dachgeschoss als Ausbaureserve. Im Gegensatz zu den anderen Familien in ihrer Straße verzichteten die Zobels aber auf zusätzlichen Wohnraum. Es musste auch so reichen.
Einmal im Monat brachte sein Vater Geld mit nach Hause und legte es auf den runden Esstisch in der Küche, an dem die Eltern oft mit den Nachbarn saßen und Doppelkopf spielten. Sein Gehalt wurde zwar schon aufs Konto überwiesen (die Lohntüte war etwas für Arbeiter), aber wenn Otto Zobel mit seiner Frau die einzelnen Posten durchging, sollte auch Bares auf dem Tisch liegen. Das machte die Haushaltsführung noch übersichtlicher, als sie ohnehin schon war, denn der finanzielle Spielraum war gering. Wenn seine Eltern den kommenden Monat planten, ging es um die wirklich notwendigen Dinge und nicht darum, irgendwelche Wünsche der Kinder zu erfüllen. Das Geld wurde in drei Haufen eingeteilt: einen fürs Essen, einen für die Kleidung und einen für Sonstiges. Der war immer der kleinste. Im Grunde waren die Zobels auch für damalige Verhältnisse arm, ohne dass man es ihnen ansah. Rainers Mutter legte bei sich und den Kindern viel Wert auf gute, gepflegte Kleidung, die sie überwiegend selbst schneiderte. Auch wenn das Geld knapp war, sollte doch alles seinen Schick haben.
Читать дальше