Zu (6): Spielen-Können stellt in zweierlei Hinsicht eine nicht zu unterschätzende und wahrscheinlich nicht ersetzbare Voraussetzung für moralisches Verhalten dar. Zum einen lassen sich ins Spiel gefahrlos aggressive, sadistische oder verführerische Impulse einbringen, weil sie nicht tatsächlich ausgeführt, sondern nur angedeutet werden (Bittner 1983; Schwabe 2019, 210 ff.). Im Spiel jemanden totzuschießen oder ihm einen Kinnhaken zu verpassen oder – wie bei Mädchen beobachtet – einem untreuen Ehemann Nägel und Scherben ins Bett zu legen oder das eigene Kind in den Keller zu sperren, schadet niemandem, der sich auf das Spiel als einem der Wirklichkeit enthobenen Rahmen eingelassen hat. Winnicott hat für die Welt des Spiels den Ausdruck intermediär geprägt und meint damit einen eigenen Bereich zwischen Realität und Traum (Winnicott 1987, 49 ff.). Die dort eingebrachten Impulse fühlen sich echt an und werden doch fiktionalisiert, indem sie mit Gesten angedeutet (das Hineinstreuen der Glasscherben) oder kontrolliert ausgeführt werden (z. B. der Schlag stoppt weit vor dem Körper des mitspielenden Kindes). So werden für diese Impulse, die im Alltag nicht mehr toleriert werden, Orte gefunden, wo sie einerseits ausgedrückt werden dürfen und andererseits beherrscht werden. Dass sie zuverlässig einen Platz im Spiel haben, hilft dem Kind dabei, in der Realität auf sie zu verzichten und sich dort strengeren Maßstäben zu unterwerfen.
Freilich kann die mit diesen Impulsen verbundene Erregung ins Spiel einbrechen (die Kontrolle gelingt nicht) und es verderben, weil es damit entgleist. Das passiert immer wieder, wobei Kinder lernen, damit umzugehen, und sich diesbezüglich genau beobachten und kontrollieren. Insofern handelt es sich beim Spielen um einen Selbstbildungsprozess par excellence, der die Kinder weiterbringt, meist ohne dass Erwachsene eingreifen müssten. Freilich wird das Mitspielen von Erwachsenen diese Prozesse mit befördern.
Genauso wichtig für die moralische Entwicklung wie das Phantasiespiel ist das Regelspiel wie Mensch-Ärgere-Dich-Nicht, Mau-Mau oder auch Fangen und Fußballspielen. Alle diese Spiele operieren mit vorgegebenen Regeln, denen sich das Kind unterwerfen muss, wenn es »richtig« spielen will (Krappmann 1983). Schon bei sechsjährigen Kindern kontrollieren beide Spieler die Einhaltung der Regeln und geben sich darüber Rückmeldungen: »Schummeln gilt nicht!«. In den Rahmen von Spielen mit Wettkampfcharakter kann man (Größen-)Phantasien vom Besiegen eines Gegners einbringen, muss aber damit zurechtkommen, dass das Gegenüber ähnliche Phantasien hegt. Das Spiel eröffnet einen Raum und organisiert einen geordneten Prozess, in dem Sieg und Niederlagen erlebt und zugleich begrenzt bleiben (G. Bateson, ebd. 246 ff.). Dazu müssen die Gewinnchancen und damit die für das Spiel erforderlichen Fähigkeiten halbwegs gleich verteilt sein (wenn die Chancen zu unterschiedlich verteilt sind, macht das Spiel keinen Spaß). Im besten Fall erlebt man, dass es eine nächste Runde gibt und sich Sieg und Niederlage abwechseln. Auch hier kann die mit dem Spiel verbundene Erregung ins Spiel einbrechen, sodass man versucht, die Regeln zu verändern oder zu unterlaufen, wenn man zu verlieren droht. Nirgendwo wird so oft diskutiert und gestritten wie bei Regelspielen, da diese den Rahmen, aber nicht alle Eventualitäten festlegen (Krappmann, ebd. 116 f.). Manchmal entstehen daraus neue Abmachungen, die sich noch echter anfühlen, weil man selbst bei ihrer Aushandlung mitgewirkt hat. Manchmal eskaliert der Streit aber auch und läuft ein Spielpartner anschließend wütend weg und erklärt den Sieg des Anderen für ungerecht. Dennoch machen die meisten Kinder immer wieder neue Anläufe mit Spielen nach Regeln, so als hätten sie verstanden, dass sie weder um diese Form noch um das Aushalten der damit verbundenen Frustrationen herumkommen, sondern daran wachsen.
So weit ein Überblick über das, was Kinder ins Jugendalter mitbringen sollten, um den Erwartungen von Schule und Freunden an regelkonformes Verhalten und die Einhaltung von Grenzen halbwegs gerecht werden zu können. Diese Ansprüche lassen sich nicht mit Hilfe von ein, zwei oder drei Kompetenzen erfüllen, schon gar nicht mit isolierten Fähigkeiten wie dem moralischen Räsonieren oder einem prompten Gehorsam. Das Entscheidende ist, dass von außen gesetzte Regeln zu inneren Strukturen und Grenzen werden.
Dazu bedarf es eines ganzen Netzwerks interagierender Fähigkeiten auf unterschiedlichen Ebenen (emotional, kognitiv, sozial) und in unterschiedlichen Modi der Existenz (Erleben, Reflektieren, Handeln). Anders als aus einem Netzwerk – oder aus einem individuellen Dickicht –, aus persönlichen Befähigungen ist das, was Kinder und Jugendliche brauchen, um sich sozial verträglich zu bewegen und Konflikte auf faire Weise auszutragen, nicht zu bekommen.
Es ist klar, dass es diesbezüglich eine erhebliche Varianz zwischen Kindern und Jugendlichen einer Klasse oder einer Konfirmandengruppe etc. geben wird. Kinder sind in diesem Alter hinsichtlich ihrer kognitiven und emotionalen Kompetenzen unterschiedlich weit entwickelt. Es ist gut möglich, dass manche sprachlich genau anzugeben wissen, was von ihnen erwartet wird, und das auch selbst richtig finden. Aber sie sind noch nicht in der Lage, ihr Verhalten entsprechend zu steuern. Andere verhalten sich zwar diszipliniert, lassen es aber an Interesse an Anderen und an Empathie fehlen und können sich nicht gut mit anderen abstimmen. Wieder andere haben keine Probleme damit, sich in offizielle Ordnungen einzufügen, verhalten sich aber unsozial, wenn sie sich unbeobachtet wähnen.
Neben individuellen Variationen, die mit angeborenem Temperament und unterschiedlichem Entwicklungstempo zu tun haben, muss man damit rechnen, dass die skizzierten Voraussetzungen nicht überall gleichermaßen gefördert bzw. erreicht wurden und sich einzelne Kompetenzen häufig nicht so verbunden haben, wie es nötig wäre, um sich gegenseitig unterstützen zu können. Ähnlich wie bei der sprachlichen Entwicklung und dem Zugang zu Bildung sind die familiären Bedingungen dafür nicht immer günstig. Die Lernprozesse, die in KiTa und Schule stattfinden, können hier einiges kompensieren, aber nur eingeschränkt Grundlagen dafür schaffen. »Wissenschaftliche Studien zeigen übereinstimmend eine Prävalenz psychischer Störungen bei Kindern in Deutschland zwischen 15 und 20 % in Verbindung mit einer deutlichen Risikoverschärfung von Kindern und Jugendlichen aus niedrigen Statusgruppen« (Opp & Otto, 2016, 186). Nach einer Untersuchung von Groos & Jehles weisen dort etwa 30 % der Kinder mit zehn Jahren deutliche Entwicklungsverzögerungen auf (Groos & Jehles 2015; Alt & Beier 2012), die, wenn sie erkannt werden und förderlich mit ihnen umgegangen wird, durchaus noch aufgeholt werden können (Dornes 2012, 400). Für emotionale Grundlagen, insbesondere die Frage von Bindungsformen, können sich aber Entwicklungsfenster bereits geschlossen haben (Großmann u. a. 1989). Solche Entwicklungen können, wenn überhaupt, nur noch unter therapeutischen Bedingungen nachgeholt werden. Dabei können sie in sozialpädagogisch ausgerichteten Erziehungshilfen oft besser hergestellt und genutzt werden als in klassischen Therapieformen, weil sich Jugendliche oft schlicht weigern, dort hinzugehen, oder nicht über die inneren Strukturen verfügen, regelmäßige Termine pünktlich wahrzunehmen (Baer 2019, Schmid 2004).
1.2 Jugendspezifische Moralentwicklung als Entwicklung selbstbestimmter Ziele
Jugendliche bauen auf vielem auf, was sie in der Kindheit gelernt haben, um damit neue und alte Aufgaben zu bewältigen (vgl. Zimmermann 1999; Göppel 2019, 164, von Salisch/Seiffge-Krenke 2008). Insbesondere Empathie und Perspektivenübernahme, aber auch das Spielen werden zuverlässige Stützen für die Bewältigung der Anforderungen in der nächsten Lebensetappe. wenn auch in erweiterten bzw. neuen Formen (  Kap. 2und
Kap. 2und  Kap. 5). Aber das moralische Selbst kann, will und muss sich weiterentwickeln. Die wichtigsten jugendspezifischen Aufgaben bestehen in einer Autonomisierung der Moral, die sich von externen Autoritäten ablösen können muss, und der kontextspezifischen Ausbalancierung von Normenbeachtung und Eigensinn. Wie wir sehen werden, geht es in diesem Lernprozess nicht nur darum, »hinreichend gut«, sondern immer wieder auch »hinreichend schlecht« oder besser »hinreichend unangepasst« handeln zu können (Bittner 2016, 31). Denn an unterschiedlichen Orten wird von den Jugendlichen Unterschiedliches erwartet und erwarten sie auch von sich selbst die Beachtung je anderer Werte und Regeln wie auch je andere Formen dieser Ausbalancierung. Es kommt demnach darauf an, sich flexibel verhalten zu können, was Nicht-Angepasstheit impliziert, ohne dabei gegen zentrale Werte zu verstoßen oder die eigene, sich formierende Identität ins vollends Diffuse entgleiten zu lassen.
Kap. 5). Aber das moralische Selbst kann, will und muss sich weiterentwickeln. Die wichtigsten jugendspezifischen Aufgaben bestehen in einer Autonomisierung der Moral, die sich von externen Autoritäten ablösen können muss, und der kontextspezifischen Ausbalancierung von Normenbeachtung und Eigensinn. Wie wir sehen werden, geht es in diesem Lernprozess nicht nur darum, »hinreichend gut«, sondern immer wieder auch »hinreichend schlecht« oder besser »hinreichend unangepasst« handeln zu können (Bittner 2016, 31). Denn an unterschiedlichen Orten wird von den Jugendlichen Unterschiedliches erwartet und erwarten sie auch von sich selbst die Beachtung je anderer Werte und Regeln wie auch je andere Formen dieser Ausbalancierung. Es kommt demnach darauf an, sich flexibel verhalten zu können, was Nicht-Angepasstheit impliziert, ohne dabei gegen zentrale Werte zu verstoßen oder die eigene, sich formierende Identität ins vollends Diffuse entgleiten zu lassen.
Читать дальше
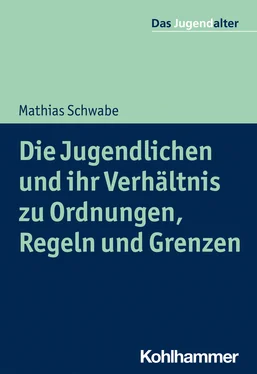
 Kap. 2und
Kap. 2und 










