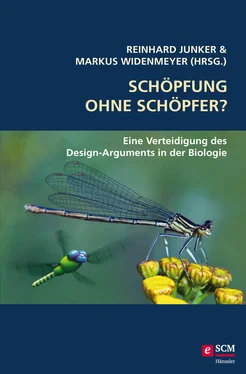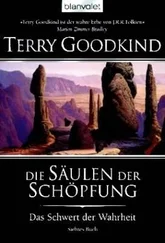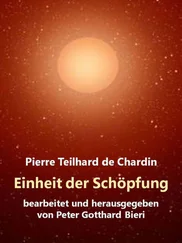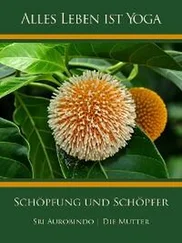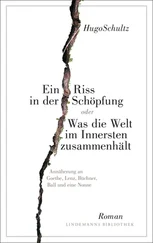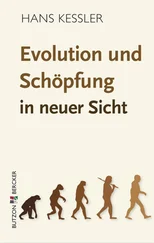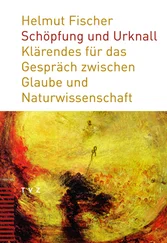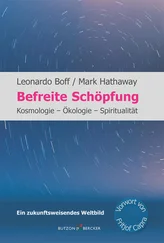Schöpfung ohne Schöpfer?
Здесь есть возможность читать онлайн «Schöpfung ohne Schöpfer?» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Schöpfung ohne Schöpfer?
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Schöpfung ohne Schöpfer?: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Schöpfung ohne Schöpfer?»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Schöpfung ohne Schöpfer? — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Schöpfung ohne Schöpfer?», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
• die Entstehung von evolutionären Innovationen oder Neuerungen („survival of the fittest“ gegenüber „arrival of the fittest“);
• Entwicklungsprozesse, welche Homologie und Homoplasie hervorbringen und eine Erklärung dafür, warum verschiedene Eigenschaften unterschiedlich konserviert sind;
• die Verbindung zwischen Genotyp und Phänotyp durch die kausalen Vorgänge der Epigenese;
• entwicklungsbiologische und andere Formzwänge, die die Produktion von Varianten beeinflussen;
• die Entstehung von Entwicklungsmodulen;
• die verlässliche Reproduktion von Entwicklungssystemen, deren Eigenschaften nicht durch Gene allein erklärt werden können (Vererbung im weiteren, embryonalen Sinne).
2 | Alternative Evolutionstheorien im 19. und 20. Jahrhundert (nach TÖPFER 2011, S. 543)
1. Mutationstheorie (z. B. DE VRIES 1901; SIMPSON 1944 „quantum evolution“; GOULD 2002 „punctuated equilibrium“): sprunghafte Veränderung von organischen Formen mit der Entstehung neuer Typen in einer Phase raschen Wandels, Wechsel von Phasen der Konstanz mit Phasen des plötzlichen Umbruchs
2. Biosphärentheorien und Evolutionstheorien auf globaler Ebene (z. B. VERNADSKYS Biosphärentheorie 1926): Organismen sind nicht passiv an ihre Umwelt angepasst, sondern haben in der Erdgeschichte aktiv die Erdkruste mitgeformt.
3. „Wissenschaftlicher“ Kreationismus (z. B. Formenkreislehre KLEINSCHMIDTS: Typenevolution ohne gemeinsame Abstammung von einer Urform von 1925): Die Organismen sind auf nicht natürliche Weise entstanden und lassen sich typologisch in Arten im Sinne von integrierten, stabilen Systemen („Formenkreisen“) ordnen.
4. Alt-Darwinismus (z. B. bei HAECKEL 1866, PLATE 1913): Die Evolution beruht auf der Kombination verschiedener Faktoren, unter ihnen der Darwin’sche Faktor der Selektion, lamarckistische Elemente der Vererbung erworbener Eigenschaften und orthogenetische Kräfte der gerichteten Veränderung.
5. Neolamarckismus (z. B. LYSSENKO 1948; BÖKER 1935): Die evolutionäre Veränderung von Organismen erfolgt durch Änderungen ihrer anatomischen Konstruktion, die vererbt wird.
6. Idealistische Morphologie (z. B. NAEF 1919; REMANE 1952): Die Morphologie liefert die Grundlage für eine Einteilung der Organismen in Typen, die in der Evolution verändert wurden; die Typeneinteilung geht der Rekonstruktion der Phylogenese methodisch und zeitlich voraus und nicht umgekehrt.
7. Saltationismus (z. B. SCHINDEWOLF 1944; GOLDSCHMIDT 1940): „Hopeful-Monster-Theorie“, neue Merkmalskombinationen (Baupläne) entstehen in der Evolution spontan und unvermittelt aufgrund von Groß- oder Makromutationen, sodass sich die Stammesgeschichte einer Gruppe in charakteristische Phasen der Bildung, Konstanz und Auflösung von Typen (Typogenese, Typostase, Typolyse) einteilen lässt.
8. Orthogenese (z. B. NÄGELI 1884; BERG 1922; GUTMANN 1969): Die Veränderung der Merkmale von Organismen verläuft in bestimmten Bahnen („constraints“), die durch innere und äußere Faktoren determiniert sind. Diese Faktoren schließen die Annahme eines zusätzlichen richtenden Prinzips (Vervollkommnungsprinzip) mit ein, welches unabhängig von der Umwelt wirkt und z. T. auf einen schöpferischen Geist zurückgeführt wird.
9. Symbiogenese (z. B. MEREŽKOVSKIJ 1910): Gleichberechtigt neben dem Faktor der Konkurrenz bildet die Symbiose ein zentrales Prinzip des Lebens und seiner Veränderung in der Evolution.
Eine ähnliche Liste mit 24 unbeantworteten Fragen innerhalb evolutionstheoretischer Modellierungen veröffentlichten 2003 MÜLLER und NEWMAN (siehe Kastentext).
Auf einer im November 2016 in London durch die Royal Society durchgeführten Konferenz unter dem Titel „New Trends in Evolutionary Biology“ wurden diese offenen Fragen erneut thematisiert. Die Kontroverse zwischen den Vertretern der EES und der ESET blieb ohne klärende Ergebnisse (für Details siehe BATESON et al. 2017).
3 | Offene Fragen zur morphologischen Evolution nach MÜLLER & NEWMAN (2003)
1. Burgess-shale-Effekt: Weshalb entstanden die Baupläne der Vielzeller explosionsartig?
2. Homoplasie: Weshalb entstehen ähnliche Gestalten unabhängig und wiederholt?
3. Konvergenz: Weshalb produzieren entfernt verwandte Linien ähnliche Designs?
4. Homologie: Weshalb organisieren sich Bauelemente als fixierte Baupläne und Organformen?
5. Neuheit: Wie werden neue Elemente in bestehende Baupläne eingeführt?
6. Modularität: Weshalb werden Design-Einheiten wiederholt verwendet?
7. Constraint: Weshalb sind nicht alle Design-Optionen eines phänotypischen Raums verwirklicht?
8. Atavismen: Weshalb erscheinen Merkmale, die lange Zeit in einer Linie verschwunden waren, erneut?
9. Geschwindigkeit: Weshalb sind die Raten morphologischer Veränderungen ungleich?
MÜLLER & NEWMAN listen weitere 15 offene Fragen aus diesen Gebieten auf:
• Beziehung zwischen Genotyp und Phänotyp in Ontogenese und Phylogenese
• Epigenese und ihre Rolle in der morphologischen Evolution
• Theorie der morphologischen Evolution
Evolutionsbiologie
Unbestreitbar ist: Nicht-teleologische Ursprungsmodelle liefern legitime und heuristisch fruchtbare Ansätze, um den vielfältigen Geheimnissen des Lebens neben der funktional-analytisch arbeitenden Biologie auf die Spur zu kommen (z. B. vergleichende Biologie auf molekularer und genetischer Ebene, Möglichkeiten und Grenzen phänotypischer Veränderungen durch Mutationen). Die Evolutionsbiologie muss aber, wie jede andere Forschungsrichtung auch, Rechenschaft darüber ablegen können, welche Rahmenbedingungen der Formulierung ihrer jeweiligen wissenschaftlichen Theorien zugrunde liegen. Um nicht weiter einer Hypostasierung ihres Gegenstandes („Evolution“) oder ihrer Modelle („Evolutionstheorie“) anheim zu fallen und um einen innerwissenschaftlichen Diskurs führen zu können, muss auch die Evolutionsbiologie folgende Fragen beantworten (nach GUTMANN 1996):
1. Was ist das Erkenntnisinteresse (Gegenstand) der jeweiligen Wissenschaft?
2. Welche Erkenntnismittel, Methoden, etc. werden zum Bearbeiten der jeweiligen Fragestellungen eingesetzt?
3. Welche (wohlbegründeten) Aussagen sind unter den gegebenen Bedingungen (1 und 2) möglich?
Für die Evolutionsbiologie ist das Erkenntnisinteresse bzw. der Forschungsgegenstand die „Evolution“ als hypothetischer historischer Naturprozess. Wie bereits festgehalten, ist „Evolution“ so verstanden kein empirisch beobachtbarer Naturvorgang und kann nicht als etwas unhinterfragbar Vorliegendes deklariert werden. Wird dagegen „Evolution“ im Sinne einer Leitidee oder als Konzeptionalisierung a priori für die Forschung genutzt, ist dies entsprechend zu kennzeichnen und bei der Deutung der daraus gewonnenen Ergebnisse und Aussagen zu berücksichtigen.
Ein Beispiel zur Illustration: In einem auf embryonalen Ähnlichkeiten basierenden Stammbaum des Auges geht die Leitidee über Evolution ein, dass die Nähe der stammesgeschichtlichen Verwandtschaft mit einem höheren Grad an embryonaler Ähnlichkeit korreliert. Dagegen wird der auf paläontologischen Befunden basierende Stammbaum des Auges von der Leitidee über Evolution bestimmt, dass in der Regel in älteren Gesteinsschichten Vorläufer und in jüngeren Gesteinsschichten modernere Versionen der Augen zu finden sind. Beide Stammbäume repräsentieren und beweisen nicht den tatsächlichen Ablauf der Augenevolution. Sie sind eine Modellierung, die für oder gegen einen spezifischen hypothetischen Ablauf der Augenevolution spricht.
Die heutige Evolutionsbiologie, die sich als ateleologisches Programm dem Gegenstand „Evolution“ als zu erforschenden historischen Naturprozess stellt, möchte zwei grundsätzliche Fragen beantworten: Aus welcher Art A ist Art B hervorgegangen und was sind die (rein natürlichen) Ursachen des Wandels bzw. wie ist dieser auf der Grundlage bekannten biologischen Wissens plausibel erklärbar? Evolutionstheoretische „Erklärungen“ tragen Berichtscharakter, da sie historisch rekonstruktive Theorien sind, und sind keine Erklärungen im naturwissenschaftlichen Sinne (vgl. den Beitrag „Gibt es eine naturwissenschaftliche Evolutionstheorie?“ in diesem Band). Damit kann der Naturvorgang „Evolution“ (Erklärungsziel) immer nur als ein „Verlauf im hypothetischen Modus“ (GUTMANN 2005) und eben nicht als Tatsache (wie eine Mondfinsternis) beschrieben werden. Auch wenn sich die historischen Rekonstruktionen auf kausale oder funktionale Aussagen bzw. Erklärungen der Biologie berufen und somit empirischen Charakter tragen, sind diese jedoch selbst weder Kausal- noch Funktionsaussagen. Eine historische Rekonstruktion der Entstehung des Auges erklärt nicht dessen physiologische Funktion als Sinnesorgan oder seine ontogenetische Verursachung, braucht aber dieses Wissen, um mögliche evolutionstheoretische Schlüsse ziehen zu können. Und noch einmal zur Erinnerung: Die Untersuchung der physiologischen Funktion als Sinnesorgan und die Klärung seiner ontogenetischen Verursachung benötigt umgekehrt Evolution als historische Rahmentheorie nicht.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Schöpfung ohne Schöpfer?»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Schöpfung ohne Schöpfer?» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Schöpfung ohne Schöpfer?» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.