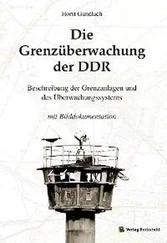Am Wochenende fuhren wir hinaus aus dem Häusermeer ins Brandenburgische. Unser Auto war inzwischen in der DDR zugelassen. Die Buchstaben QA auf dem Kennzeichen symbolisierten den Status als akkreditierter Korrespondent. Die Ziffer 57 stand für Bundesrepublik Deutschland. Jeder Staat, der in Ost-Berlin eine diplomatische Mission unterhielt, hatte eine spezielle Kennziffer. Geordnet nach der zeitlichen Reihenfolge, in der die Beziehungen aufgenommen worden waren. Jeder Volkspolizist wusste sofort, mit wem er es zu tun hatte. Immerhin wurden wir an der Stadtgrenze zwischen der »Hauptstadt« und der DDR nicht angehalten und kontrolliert, wie das in unserer Anfangszeit mit Personen in Autos aus West-Berlin oder der Bundesrepublik geschah.
Wir fuhren über Straßen, die von mächtigen Laubbäumen dicht gesäumt waren. Ihre Kronen berührten sich und bildeten ein Dach, unter dem wir uns bewegten. Wir freuten uns an dem ungewohnten Anblick. Wenn wir in Westdeutschland unterwegs waren, konnte man oft nicht erkennen, wo eine Gemeinde aufhörte und wo eine andere begann. Die Landschaft war zersiedelt. Hier, in der DDR, war ein Dorf noch ein Dorf. Und dazwischen Felder, Wälder und Wiesen. Manchmal holperten wir über Kopfsteinpflaster. Wir dachten an unsere begradigten, zu Schnellpisten ausgebauten Straßen in der Bundesrepublik, an denen man Bäume gefällt hatte, weil sie ein Sicherheitsrisiko darstellten. Hier sah es noch so aus wie in der Zeit vor dem Krieg. Vermutlich hätten die SED-Regenten die Verbindungswege auf ihrem Territorium gern nach westdeutschem Muster modernisiert. Dass dies nicht geschah, war weniger ihrer Liebe zur Natur geschuldet als dem Mangel an Arbeitskräften und Material.
Was wir bei unseren Ausflügen wahrnahmen, erinnerte uns häufig an die eigene Kindheit in den Nachkriegsjahren. In den Gärten von Freunden kam das Wasser nicht aus der Leitung, sondern aus einer Pumpe. Für unsere Kinder, die nackt umhersprangen, war das ein Erlebnis. Auch die Erwachsenen waren in ihrem Verhalten ungezwungen. Viele badeten in den Seen ohne Badehose und Badeanzug. FKK war weit verbreitet. Als nach dem Ende der DDR unter dem Einfluss westdeutscher Kurdirektoren die Freizügigkeit des Nacktbadens an der Ostsee wieder eingeschränkt wurde, liefen viele Einheimische gegen die neue Bevormundung Sturm.
Und noch etwas fiel uns bei unseren Erkundungstouren auf. An Halteplätzen der Landstraßen standen mitunter Dörfler und boten Früchte aus ihrem Garten zum Kauf an. Äpfel, Birnen und Beeren. Frisch geerntet und in der Regel ungespritzt. Wir genossen den ursprünglichen Geschmack. Auch Pilze wurden offeriert. In den Kaufhallen hätte man wohl vergeblich danach gesucht. Wir gewöhnten uns daran, dass in der sozialistischen Mangelgesellschaft das Warenangebot der jeweiligen Jahreszeit entsprach. Kohl im Winter, Kirschen im Sommer, Pflaumen im Herbst. Apfelsinen, die für Devisen importiert werden mussten, spendierte die Obrigkeit ihren Untertanen meistens nur zu Weihnachten.
DDR-Bürger beneideten die Westdeutschen um ihren kulinarischen Überfluss. Wir dagegen fanden, dass sich die Ostdeutschen – wenn auch nicht freiwillig – ein Gefühl für den natürlichen Rhythmus des Jahres und der Natur bewahrt hatten. Weil nicht alles, wie in den westlichen Ländern, zu jeder Zeit verfügbar war. Etwa frische Erdbeeren im Winter – eingeflogen aus dem Süden. Werden Freude und Genuss nicht gedämpft, wenn sie immer zu haben sind? Waren die Menschen in der DDR, ohne dass ihnen dies bewusst war, wegen des allgegenwärtigen Mangels vor Übersättigung geschützt? Wir behielten solche Überlegungen für uns, aus Sorge, wir könnten für zynisch oder elitär gehalten werden. Im Dezember brachte meine Frau aus West-Berlin frische Blumen mit, die es in Ost-Berlin nicht gab. Eine DDR-Nachbarin kam zu Besuch. Sie sah den Strauß und sagte: »Rote Tulpen unter dem Adventskranz. Das ist ja pervers.«
Am 6. Juli 1993 sitze ich in einem Raum der Stasi-Unterlagenbehörde und lese in meinen Akten. Stunde um Stunde arbeite ich mich durch die Berge von Papier. Wie schon am Tag zuvor. Viele Opfer der SED-Diktatur haben sich vor diesen Stunden der Wahrheit gefürchtet. Die Vorstellung, jemand aus ihrem Verwandten- und Freundeskreis könnte sie bespitzelt haben, hat ihnen schon vor der Konfrontation mit den Aufzeichnungen schlaflose Nächte bereitet. Mir nicht. Ich bin vorbereitet und ohne Illusionen. Neugierig bin ich, das ja. Neugierig auf das Material, das Erich Mielkes Leute über mich gesammelt haben. Doch im Gegensatz zu DDR-Bürgern fühle ich mich nicht als Opfer, eher als publizistischer Gegenspieler der untergegangenen Staatsmacht.
Was ich über Inoffizielle Mitarbeiter bei der Lektüre erfahre, regt mich nicht sonderlich auf. Echte Freunde sind es nicht gewesen, die auf mich angesetzt waren. Es waren überwiegend Leute, die ich etwas geringschätzig als »Laufkundschaft« betrachtete. Bekannte, die ich ausgefragt, »abgeschöpft«, wie es im Stasi-Jargon heißt, aber nicht ins Vertrauen gezogen habe. Was andere schmerzhaft erlebten, bleibt mir anscheinend erspart. Niemand, zu dem ich eine enge Beziehung habe, hat mich hintergangen. Ich lese weiter. Ohne Beunruhigung und ohne besondere Emotionen. Sachstandsberichte mit Bewertungen meiner journalistischen Arbeit, Protokolle über Observierungen, IM-Berichte, Operativpläne, Vermerke und Auswertungen. Verfasst in einem gleichbleibend hölzernen Bürokraten-Deutsch.
Plötzlich wird mir heiß. Ich blicke auf eine Kopie mit Aufzeichnungen in meiner Handschrift. Ich fühle, wie mir Blut in den Kopf schießt. Hastig blättere ich, schaue mir die nächsten Seiten an. Vor mir liegen die Ablichtungen eines sehr privaten Tagebuchs. In einem Stenoblock habe ich meine Empfindungen während einer kritischen Phase unseres Ehelebens aufgeschrieben. Er lag ganz unten in meiner Schreibtischschublade. Begraben unter dienstlichen Papieren. Und nur für mich bestimmt. Verdammt noch mal, denke ich. Was geht den Staatssicherheitsdienst unser Intimleben an? Das war naiv. Dass der Stasi-Apparat keine Tabus kennt, war mir eigentlich klar. In der Theorie. Jetzt bin ich mit der Praxis konfrontiert. Der Gedanke an die heimlichen Mitleser wühlt mich auf. Wut mischt sich mit Hilflosigkeit, Erschrecken mit Scham.
Es dauert, bis sich an diesem Tag meine Erregung legt und ich meine Fassung zurückgewinne. Ich begreife, dass ich es mit den Ergebnissen einer konspirativen Durchsuchung meines Büros in der Clara-Zetkin-Straße zu tun habe. Am 26. März 1978 sind die Experten der Hauptabteilung VIII in mein Dienstzimmer eingedrungen. In einer sorgfältig vorbereiteten Aktion, die von der Führungsspitze des Staatssicherheits-Ministeriums genehmigt worden war. Der Einbruch war ja nicht ohne Risiko. »Stellen Sie sich vor, unsere Leute wären dabei erwischt worden«, hat mir lange nach dem Ende der DDR ein ehemaliger Stasi-Offizier gesagt. »Was das für ein Aufschrei im Westen gewesen wäre.«
Das Öffnen eines gewöhnlichen DDR-Schlosses war für die Spezialisten des MfS kein Problem. Es war ein Sonntag, Ostersonntag. Vermutlich kamen sie, als es dunkel war. Wo ich war, wussten sie. Ich stand unter Beobachtung. Sie müssen sicher gewesen sein, dass sie niemand überraschen würde. Kein Büromieter der Etage, kein zufälliger Passant. Die Fahnder durchstöberten Schubladen, Schränke und Regale. Was ihnen wichtig erschien, haben sie fotografiert. Adressbücher, Kalender, Briefe, Abrechnungen. Auch Notizen für meine journalistische Arbeit. Auf manchen Seiten sind noch die in dünnen Handschuhen steckenden Finger des Menschen zu sehen, der die Dokumente unter die Kamera gehalten hat. Nichts habe ich in der Zeit danach von dem heimlichen Besuch gemerkt. Alles, was die Profis angefasst und erschnüffelt hatten, lag auf dem gewohnten Platz. Spuren haben sie nicht hinterlassen.
Читать дальше