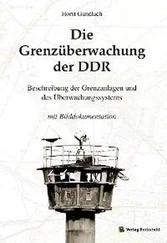Im Haus mit seinen 18 Etagen gab es zwei Fahrstühle. Hergestellt in einem Volkseigenen Betrieb. Die wurden von den vielen Mietern und ihren Gästen stark beansprucht. Zeitweise versagten sie den Dienst. Wenn man Pech hatte, blieb der Aufzug zwischen zwei Stockwerken stecken. Tagsüber war das nicht schlimm. Ein Hausmeister war immer in der Nähe. Am späten Abend oder in der Nacht musste man Geduld haben, bis man aus der engen Kabine befreit wurde. Als die Fahrstühle mal wieder nicht fuhren und meine Frau nicht wusste, wie sie den Kinderwagen ins Erdgeschoss bringen sollte, war es mit ihrer Geduld zu Ende. Bei ihr hatte sich viel Unmut gestaut: Weil der Strom ausfiel und sie die Kindermahlzeit auf einem Spirituskocher warm machen musste. Weil ein offener Kabelschacht direkt vor dem Hauseingang verlief, den man nur auf einer schmalen Bohle überqueren konnte. Erst im Herbst, als am 7. Oktober der 25. Jahrestag der DDR-Gründung mit großem Propaganda-Aufwand gefeiert wurde, waren die Mängel rund ums Haus behoben. Die Machthaber waren um ihr Prestige besorgt.
Meine Frau packte also unsere Kinder ins Auto und fuhr zum staatlichen Dienstleistungsamt. Sie war es gewohnt, ungelöste Probleme selbst anzugehen und nicht zu warten, bis ihr Mann dafür Zeit hat. Bei der Pförtnerloge verlangte sie nach dem Leiter, um sich zu beschweren. Das war etwas blauäugig. Sie wurde weder zum Chef vorgelassen noch zu einem anderen Mitarbeiter. Stattdessen erschien eine Sekretärin und teilte ihr förmlich mit: »Frau Pragal, Sie sind für uns kein Gesprächspartner. Der Funktionsträger ist Ihr Mann.« Meine Frau war sprachlos. Eine solche Auskunft hatte sie nicht erwartet. Schon gar nicht in einem Staat, der sich mit der Emanzipation der Frauen brüstete. Wütend fuhr sie zur Ständigen Bonner Vertretung, um dort ihren Frust abzuladen. Deren Leiter Günter Gaus nahm sich tatsächlich Zeit für sie. Er hörte sich ihre Beschwerden geduldig an. Aber er war wohl der falsche Adressat. Auf das hierarchische Gehabe in realsozialistischen Behörden hatte die Ständige Vertretung keinen Einfluss. Für mich hat das Erlebnis im Dienstleistungsamt nachhaltige Folgen. Immer wenn ich mich vor einer unangenehmen häuslichen Aufgabe drücken will, sagt meine Frau süffisant: »Funktionsträger, mach du das mal.«
Am Morgen nach unserer ersten Nacht im neuen Heim wollte ich frische Brötchen zum Frühstück besorgen. Der Hausmeister hatte mir einen Tipp gegeben. Ich machte mich zu Fuß auf den Weg. Ich ging die Jacques Duclos- (heute Möllendorff-)Straße Richtung Lichtenberger Rathaus, vorbei an der kleinen Pfarrkirche, und entdeckte auf der rechten Straßenseite einen Bäckerladen. Er war eines von den Geschäften, die privat geführt wurden. Der Geruch aus der Backstube steigerte meinen Appetit. Ich verlangte vier Schrippen, die kosteten zusammen 20 Pfennige Ost. Die Verkäuferin legte mir die Brötchen auf die Ladentheke. Ich schaute sie verdutzt an. In München bekam ich die Semmeln in einer Tüte. Die gab es hier nicht. Eine Tasche hatte ich nicht mitgenommen. Wohin mit den Brötchen? Schließlich steckte ich sie in meine Jackentasche. Es war meine erste Lektion über den Alltag in Ost-Berlin. Fortan ging ich – wie es DDR-Bürger zu tun pflegten – nicht mehr ohne Netz oder Beutel aus dem Haus.
Wir haben schnell begriffen, dass das Leben östlich der Mauer nach anderen Regeln verlief, als wir im Westen gewohnt waren. Und auch nach einem anderen Rhythmus. Ost-Berliner waren notorische Frühaufsteher. Nicht aus Lust oder Leidenschaft. Der Arbeitsprozess zwang sie dazu. Männer ebenso wie Frauen, die – anders als in der Bundesrepublik – in der DDR zu über 90 Prozent einer bezahlten Beschäftigung nachgingen.
Schon um 4.30 Uhr morgens gingen die ersten Lichter in den Wohnungen an. Ab fünf Uhr drängelten sich vor den Straßenbahnhaltestellen Werktätige auf dem Weg zur Frühschicht. Sicher, auch in Fabriken und auf Baustellen in Westdeutschland war um sechs Uhr Arbeitsbeginn. Aber hier in unserem Neubaugebiet schienen in den ersten Morgenstunden nahezu alle Bewohner auf den Beinen zu sein. Arbeiter, Büromenschen, Verkäuferinnen, Friseusen. Und viele Kinder, die – oft noch halb im Schlaf – von ihren Vätern oder Müttern zur Krippe und in den Frühhort gebracht wurden. Spätestens um halb neun waren die neuen Betonburgen, sofern keine Ausländer darin wohnten, entvölkert. Das Volk war – wie man in Berlin sagt – »auf Arbeit«.
Nicht weit von unserem Haus gab es eine Konsum-Kaufhalle. Dorthin gingen wir in der ersten Zeit einkaufen. Wir schoben den Gitterkorbwagen über den Betonboden und verglichen beim Blick in die Regale die Preise. Etliche Waren kosteten – setzte man nach dem offiziellen Umtauschkurs eine Mark Ost gegen eine Mark West – weniger als jenseits der Grenze. Das galt vor allem für die Grundnahrungsmittel, die von den Planwirtschaftlern der SED subventioniert wurden. Auch dann noch, als das Regime ökonomisch schon bankrott war. Dafür war die Auswahl der Waren wesentlich geringer und die Qualität schlechter.
Griff man ein Netz mit Kartoffeln, konnte es passieren, dass die Hälfte des Inhalts verdorben war und weggeworfen werden musste. Vor der Fleischtheke standen die Kunden in der Regel Schlange. »Könnten Sie mir bitte das Fett abschneiden«, bat meine Frau eine Verkäuferin, die dabei war, das Fleisch auszuwiegen. Die Frau sah uns an, als kämen wir vom Mond. »Das müssen Sie aber mitbezahlen«, blaffte sie uns an. »Was glauben Sie denn, wie ich der nächsten Kundin das Fett berechnen soll.« Wieder eine Lektion: Verkäuferinnen, die wie alle Werktätigen im »sozialistischen Wettbewerb« standen, konnten auf Sonderwünsche keine Rücksicht nehmen.
Unsere Annäherung an das Alltagsleben im realen Sozialismus war eine Entdeckungstour, an der ich meine Leser im Westen von Anfang an teilhaben ließ. Die meisten Bundesbürger interessierte damals nicht, was östlich von Mauer und Metallgitterzäunen bei den »Brüdern und Schwestern« passierte. Urlaubsländer wie Griechenland, Italien und Spanien waren ihnen vertraut. Über das Leben der Menschen zwischen Oder und Werra wusste der gewöhnliche Westdeutsche jedoch wenig. Es sei denn, er war von dort vor dem Mauerbau geflohen oder er hatte Verwandte. Nicht etwa, dass es keine politische Berichterstattung gab. Was Walter Ulbricht, Erich Honecker und Genossen erklärten und anordneten, wurde sehr wohl registriert. Aber wie es in den Köpfen und Herzen ihrer Untertanen aussah, blieb dem durchschnittlichen Bundesbürger verborgen. Es war ihm, glaube ich, auch ziemlich egal.
Ich schrieb auf, was ich hörte und beobachtete. In der Straßenbahn und in der Kneipe, in Geschäften und auf dem Rummelplatz, auf der Poststelle und im Theater. Aus den Tagebuch-Eintragungen wurde eine Kolumne, die unter dem Titel »In der DDR notiert« in der Wochenendausgabe der Süddeutschen Zeitung erschien und große Resonanz fand. Sie wurde von mehr Menschen gelesen als meine sonstigen Kommentare, Analysen und Reportagen, auf die ich so stolz war. Zunächst habe ich in vielen kleinen Szenen die Außenseite der Gesellschaft beschrieben. Aber je länger wir in Ost-Berlin lebten, desto mehr verwandelte sich mein Blick von dem eines Fremden in den eines Insiders, der seine Umwelt mit den Augen und den Empfindungen von Einheimischen wahrnahm.
Wenn wir schon hier in Ost-Berlin sind, so sagten wir uns, dann mit allen Konsequenzen. Meine Frau und ich nahmen uns vor, so wenig wie möglich auf die Fluchtinsel West-Berlin auszuweichen. Das hielten wir zwar nicht lange durch, aber in der Anfangszeit haben wir diesen freiwilligen Vorsatz erfüllt. Unsere Kinder waren oft krank. Auch eine Folge der verschmutzten Luft, mit der wir täglich konfrontiert wurden. Wir beschlossen, sie und uns vor Ort ärztlich betreuen zu lassen. Dazu mussten wir einen Berechtigungs-Ausweis zum Besuch medizinischer Einrichtungen der DDR beantragen. Die Jahrespauschale betrug 720 Mark pro erwachsene Person. Die Summe entsprach dem Höchstbetrag, den ein DDR-Bürger für die Sozialversicherung zahlen musste. Für die Behandlung unserer Kinder wurde keine zusätzliche Prämie erhoben. Im Haus der Gesundheit, einer Poliklinik am Alexanderplatz, war meine Frau mit den Kindern Stammgast. Lange warten musste sie selten. Ihr grüner Versicherungsausweis berechtigte sie »zur bevorzugten« ambulanten Betreuung. Klassenlos, wie es der Ideologie im sozialistischen Deutschland entsprochen hätte, war das staatliche Gesundheitswesen ohnehin nicht. Es gab ein Regierungskrankenhaus für die DDR-Prominenz. Diese Klinik stand auch den auswärtigen Missionschefs und ihren Familien sowie dem Botschaftspersonal im Diplomatenrang offen. Korrespondenten zählten nicht zu diesem erlauchten Kreis.
Читать дальше