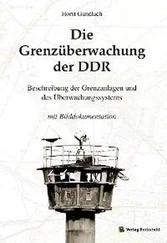Stur behaupteten die roten Staatslenker, die DDR habe sich kontinuierlich und gradlinig entwickelt. In Wirklichkeit gab es zahlreiche Wendemanöver und abrupte Kurswechsel. Erst ließ man die Zügel der Unterdrückung etwas lockerer, dann zog man sie wieder straff an. Mal versprach die SED mehr Rechtssicherheit, dann ließ sie der Willkür freien Lauf. Zeitweise führten sich die Spitzenfunktionäre als Friedensfürsten auf und trieben zugleich die Militarisierung der Schulen und der Gesellschaft voran. Widersprüche über Widersprüche, und ein Zick-Zack-Kurs gegenüber dem eigenen Volk wie gegenüber der Bundesrepublik. Je länger die Ära Honecker währte, desto stärker zeigten sich die Spuren des Obrigkeitsstaates, der seine Bürger entmündigte. Staatsverdrossenheit und Verantwortungsscheu, Arbeitsschlamperei und politische Apathie breiteten sich rasant aus. »Privat geht vor Katastrophe«, lautete der Volksspruch. Selbst viele SED-Mitglieder verfielen der Resignation. »Die Genossen werden sich schon etwas dabei gedacht haben«, sagten sie mit bitterer Ironie, wenn sie wieder einmal eine Entscheidung von oben nicht verstanden hatten.
Ihre letzte Chance, den Untergang aufzuhalten, vergaben die Herrscher im Zentralkomitee und im Politbüro, als sie sich gegen die Moskauer Reformpolitik stellten. Eigensüchtig, halsstarrig und realitätsblind. Seit seiner Gründung lebte der SED-Staat vom Wohlwollen und vom Schutz der Sowjetunion. Ohne den Rückhalt aus Moskau war die DDR nicht lebensfähig. Als Honecker dann auch noch den Massen von Flüchtlingen, die über Ungarn der DDR den Rücken kehrten, den zynischen Satz nachrief, niemand weine ihnen eine Träne nach, verloren auch treue Anhänger den Glauben an die Führungskunst ihrer selbst ernannten Herrscher. Viele SED-Mitglieder deckten die Parteibüros mit kritischen Briefen ein oder gaben desillusioniert ihre Mitgliedsbücher zurück. Honecker und seine Mitregenten, so stellte sich mir und vielen anderen Menschen nach der Grenzöffnung die Lage dar, haben ihren mit Zwang zusammengehaltenen Staat in den Bankrott geführt. Politisch, ökonomisch und moralisch. Aber wer hat das, als ich meine Arbeit als Korrespondent begann, vorausgesehen? Ich jedenfalls nicht.
Mit West-Pass nach Ost-Berlin
Unser Start in das Abenteuer DDR begann mit einem Versprechen, einer Abmachung unter Eheleuten. »Was immer künftig passiert«, sagte meine Frau, »wir dürfen niemals erpressbar werden.« Wir fuhren auf der Autobahn. München, wo wir seit Jahren zu Hause waren, lag hinter uns. Gerade hatten wir die Donau überquert. Ich wusste sofort, was sie meinte. Unsere Reise nach Berlin an einem Februartag des Jahres 1974 war kein Ausflug oder ein Wochenendtrip. Vor uns lag eine Bewährungsprobe. Wir waren dabei, unseren Wohnsitz in einen Staat zu verlegen, dessen Geheimdienst uns als »Klassenfeinde« betrachten würde. Und wenig Skrupel kannte, menschliche Schwächen auszunutzen. Bei uns, da waren wir uns einig, würden sie keine Chance haben, Vertrauen und Verlässlichkeit zu untergraben.
Vier Wochen zuvor, am 10. Januar 1974, hatte ich im DDR-Außenministerium in Ost-Berlin meinen Presseausweis als akkreditierter Korrespondent der Süddeutschen Zeitung erhalten. Das Visum und die Aufenthaltsgenehmigung »für das gesamte Gebiet der DDR«, befristet zunächst auf ein halbes Jahr, wurden in meinen bundesdeutschen Reisepass gestempelt. Fast ein Jahr hatte ich auf diesen Augenblick gewartet. Zwar hatte sich die DDR in der Folge des Grundlagenvertrages von 1972 verpflichtet, bundesdeutsche Journalisten als ständige Korrespondenten ins Land zu lassen. Die schriftliche Zusage hatte ich seit März 1973. Aber mit der Umsetzung ließ sie sich Zeit.
Als ich das Ministeriums-Gebäude am Spreeufer verließ, war mein Frust über die Schwerfälligkeit kommunistischer Bürokratie verflogen. Beschwingt ging ich die Straße Unter den Linden in Richtung Brandenburger Tor. Vorbei an der Staatsoper und der Humboldt-Universität. Nicht mehr als Tourist und Tagesbesucher, sondern als künftiger Bewohner Ost-Berlins. Einer mit einer Adresse in der »Hauptstadt der DDR«. Endlich konnte ich tun, was ich mir gewünscht und weshalb mich meine Redaktion hierher geschickt hatte: das Leben der Menschen im sozialistischen deutschen Staat beschreiben. Ihren Alltag in Beruf und Freizeit. Ihre Sorgen und ihre Freuden. Und wie sie sich eingerichtet haben in der SED-Diktatur.
Ich war nicht der erste westdeutsche Journalist, den die DDR akkreditierte. Ein paar Kollegen, unter ihnen die Vertreter der Deutschen Presse-Agentur und des Nachrichtenmagazins Der Spiegel , hatten ihre Ausweise vor mir bekommen. Aber ich war der erste, der freiwillig seinen Wohnsitz in der Bundesrepublik aufgab und ganz nach Ost-Berlin verlegte. Mit Ehefrau und zwei kleinen Kindern. Da für die ständigen Korrespondenten ebenso wie für ausländische Diplomaten Residenzpflicht bestand, hatten auch meine Kollegen eine Büro- und Wohnadresse im Ostteil der Stadt. Ihren Hauptwohnsitz behielten die meisten jedoch in West-Berlin. Und mit ihm oft auch ihren privaten Lebensmittelpunkt.
Unser neues Domizil war in einem Plattenhochhaus im Stadtteil Lichtenberg. Weißenseer Weg 2, vierte Etage, Wohnung 06. Später erhielt die Straße den Namen Ho Chi Minh. Vier Zimmer, Küche, WC, Bad, auch »Nasszelle« genannt. Kein Balkon und kein Keller. Auch Garagen gab es nicht. Dafür wurde der Parkplatz neben dem Gebäude von der Volkspolizei bewacht. Insgesamt 96 Quadratmeter Wohnfläche. Zugewiesen vom Dienstleistungsamt für Ausländische Vertretungen, einer Behörde, die eng mit dem Außenministerium und der Stasi zusammenarbeitete. Die ursprünglich bunten Tapeten – jedes Zimmer in einem anderen unruhigen Muster – hatten wir einheitlich weiß überstreichen lassen. Zum Entsetzen der Mitarbeiter, die kein Verständnis für unseren Geschmack hatten. Weiße Wände – das war nach Ansicht von SED-Funktionären typisch für Arme-Leute-Behausungen. »Die Wohnung wurde in renoviertem Zustand übernommen«, heißt es im Übergabeprotokoll. Das Haus war erst seit einigen Wochen bewohnbar. Bei der Miete zeigte das Amt einen durchaus kapitalistischen Erwerbssinn. 1200 D-Mark pro Monat kassierte der staatliche Vermieter, einzuzahlen vierteljährlich im Voraus auf ein Devisenkonto der DDR-Außenhandelsbank. Das seien eben Marktpreise, sagte man mir im Außenministerium. In Tokio seien die Mieten höher.
Die Vorbereitung auf den Umzug war mühevoll. Wochenlang waren wir in München damit beschäftigt, unseren Hausstand für den DDR-Zoll aufzulisten. Allein die Aufstellung der Bücher, die wir nach Ost-Berlin mitnehmen wollten, füllte zwölf eng beschriebene DIN-A4-Seiten. Alles musste vermerkt sein, Autor, Titel, Verlag, Erscheinungsjahr. Einige Bücher waren darunter, die der Zoll unter normalen Umständen an der Grenze beschlagnahmt hätte. Etwa Robert Havemanns »Fragen – Antworten – Fragen«. Oder die Streitschrift »Monopol-Sozialismus« des polnischen Dissidenten Jacek Kuroń. Bei uns setzte der Zoll auf jeden Einfuhr-Antrag ohne Beanstandung den Genehmigungsstempel. Versehen mit dem Zusatz: »Ohne Handelswert.«
In der leeren Wohnung warteten wir auf unsere Möbel. Unsere Kinder Markus und Katharina waren in der Obhut der Großeltern. Meine Frau und ich schauten aus dem Fenster. Unten knatterten die Trabis vorbei. Die Abgaswolken waren deutlich erkennbar. Die äußeren Rahmen der Fenster waren mit Graphitstaub überzogen, der aus den Schloten des »VEB Elektrokohle« herüberwehte. Rund ums Haus war Baustelle. Ein Plattenbau nach dem anderen wurde hochgezogen. Der Boden war aufgeweicht und von Gräben durchzogen. »Wie soll ich da mit dem Kinderwagen durchkommen«, sagte meine Frau. Die Tochter war erst ein paar Monate jung. Die Beschwernisse des Alltags – das war uns in diesem Moment klar – würde vor allem die Ehefrau zu tragen haben.
Читать дальше