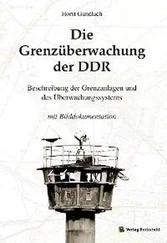Es war eine Zeit, in der unsere Kinder in manchen Nächten ins Elternbett krochen. Meistens war es der Sohn. Eines Tages entdeckten wir an seinem Körper rote Flecken, die wie Einstichstellen von Insekten aussahen. Die Ärztin im Haus der Gesundheit tippte auf Allergie. Als immer wieder neue Flecken auftraten, schilderten wir unsere Beobachtungen meiner Schwiegermutter. Die war Kinderärztin. Es könnten Wanzenbisse sein, sagte sie. »Wie alt ist eure Ärztin?« So Mitte dreißig, schätzten wir. Dann habe sie wohl mit Wanzenbissen keine praktische Erfahrung, sagte meine Schwiegermutter. Vielleicht hat uns die DDR-Medizinerin die in ihren Augen peinliche Diagnose auch nur ersparen wollen.
Wir nahmen unser Bett auseinander und fanden tatsächlich vier der kleinen, flachen Blutsauger. Wir verglichen ihre Körper mit Abbildungen in einem Tier-Lexikon, das uns DDR-Freunde geschenkt hatten. Kein Zweifel, es waren Wanzen, echte Wanzen. Sie hatten nicht meine Frau und mich, sondern nur unseren Sohn gepeinigt. Wir informierten die Hygiene-Inspektion. Als die Kammerjäger in unsere Wohnung kamen, glaubten sie, an der falschen Tür geklingelt zu haben. »Sind wir hier richtig?«, fragten sie. Bei uns sah es nicht nach Verwahrlosung aus. Sie sprühten dem Raum aus. Drei Wochen lang konnten wir unser Schlafzimmer nicht benutzen und mussten in einem anderen Raum die Nächte verbringen. Ich überlegte, wie ich das Ungeziefer eingeschleppt haben könnte. Bei meinen Dienstreisen übernachtete ich zuweilen in einem der Interhotels. Wenn ich nach Hause kam, legte ich meinen Koffer zum Ausräumen aufs Bett. Von Zeit zu Zeit, so hatte ich gehört, wurden Hotels in der DDR für ein paar Tage geschlossen. Kammerjäger reinigten Gästezimmer und sonstige Räume von allerlei Ungeziefer. Gut möglich, dass sie nicht nur Schaben jagten, sondern auch Bett-Wanzen.
Eines Tages beschloss meine Frau, sich im Städtischen Krankenhaus Friedrichshain operieren zu lassen. Die Klinik, an der in den zwanziger Jahren der Schriftsteller und Arzt Peter Bamm gewirkt hatte, genoss auch zu DDR-Zeiten einen guten medizinischen Ruf. Außerdem war sie nur ein paar Kilometer von unserer Wohnung entfernt. So konnte ich sie öfter besuchen. Gleich nach der Ankunft in einem Vierbettzimmer der Station 11 rief sie mich an und bat mich, ein paar Kleinigkeiten von zu Hause mitzubringen, darunter Messer, Löffel, Gabel und Tee. Den gab es ebenso wenig wie Bohnenkaffee. Nachthemd und Toilettenartikel hatte sie mitgenommen, aber kein Essbesteck. »Die anderen Frauen haben auch ihr eigenes dabei«, sagte sie. »Das ist hier so üblich.«
An den Betten gab es keine Nachttischlampe. Eine Glühbirne an der Decke beleuchtete den Raum. Es fehlten auch schwenkbare Tabletttische. Das Essen wurde nicht ans Bett gebracht. Die Patienten mussten aufstehen und die Mahlzeit auf dem Flur in Empfang nehmen. Wer das nicht konnte, weil er frisch operiert war, wurde von den gehfähigen Patienten versorgt. Mit dem Teller balancierte man auf der Bettdecke. Manche der Patienten halfen in der Küche. So also sah das von den Parteifunktionären hoch gepriesene Gesundheitswesen von innen aus. Wie in vielen Bereichen klafften auch hier Propaganda und Wirklichkeit auseinander.
Als es ein Jahr später darum ging, ihre Mandeln herausnehmen zu lassen, entschied sich meine Frau trotzdem erneut für das Krankenhaus Friedrichshain. Diesmal lag sie in einem Zweibettzimmer. Einer der Chefärzte der Klinik war ein gebürtiger Bayer. Ein renommierter Chirurg, der etliche DDR-Prominente unter dem Messer gehabt hatte. Nach dem Krieg war er im Osten geblieben und hatte dort beruflich Karriere gemacht. Wir hatten ihn über seine Tochter kennengelernt. Er verleugnete seine bajuwarische Herkunft nicht. Meiner Frau brachte ich täglich die Süddeutsche Zeitung ins Krankenhaus. Sie hatte mit ihm verabredet, dass er sich seine »Lieblingszeitung«, wie er sich ausdrückte, abholen durfte. Beim ersten Besuch kam er ins Zimmer und blieb wie angewurzelt stehen. Die Patientin im Nachbarbett war seine OP-Schwester aus der chirurgischen Abteilung. Er schien zu überlegen, ob er sich vor einer Mitarbeiterin die Blöße geben sollte, sich von einer Patientin aus der Bundesrepublik eine West-Zeitung aushändigen zu lassen.
»Ich hätte in diesem Moment heulen mögen«, hat mir später meine Frau gesagt. Da stand ein hoch angesehener Chefarzt und musste sich nach dem ersten Schrecken entscheiden, ob er wieder gehen oder den wahren Grund seines Besuches zugeben sollte. Was ist das für ein Staat, der seine Bürger in eine solche demütigende Lage brachte, fragte sie. Der Arzt entschied sich dafür, Farbe zu bekennen. Er begrüßte meine Frau, machte die Patientinnen miteinander bekannt und nahm später auch die Zeitung mit. Von da an kam er täglich. Und wenn er ging, hatte er eine Lektüre in der Tasche, die ihm sonst nicht zugänglich war.
Der grün uniformierte Volkspolizist, der auf einer Ost-Berliner Straßenkreuzung den Verkehr regelte, bemühte sich gar nicht erst um Höflichkeit. »Steig ab, fahr rechts ran und warte, bis ich komme«, herrschte er einen Jugendlichen an, der in den Augen des Ordnungshüters mit seinem Mofa ein wenig zu flott um die Kurve gefahren war. Doch der junge Mann, der mit vielen Gleichaltrigen das Schicksal teilte, von der Polizei besonders schikaniert zu werden, verhielt sich anders als erwartet. »Erstens haben Sie nicht du zu mir zu sagen, zweitens bleibe ich sitzen, und drittens werde ich gleich weiterfahren«, sagte der Mofa-Fahrer. Dem Volkspolizisten verschlug es die Sprache. Bevor er darüber nachdenken konnte, wie er diesem Angriff auf seine Autorität begegnen sollte, zeigte der junge Mann, Sohn eines befreundeten Mitarbeiters der Ständigen Bonner Vertretung, seine rote Diplomatenkarte. »Entschuldigung, konnte ich ja nicht wissen«, murmelte der Uniformierte und ging schnell auf die andere Straßenseite.
Die Konfrontation mit Menschen, die ihnen selbstbewusst begegneten, muss für die Vertreter der Staatsmacht ein Schock gewesen sein. Bisher waren sie gewohnt, dass sich Bürger ihres Staates bei geringsten Verstößen gegen die Regeln von Disziplin und Ordnung devot verhielten. Jetzt hatten sie es ab und zu mit Leuten zu tun, die sich ihren barschen Ton verbaten und sich nicht einfach abkanzeln ließen. Oder sich so benahmen, wie es in ihren westlichen Heimatländern üblich war. Im Bewusstsein, dass ein Polizist für die Bürger da ist. Oder zumindest da sein sollte. Zum Beispiel, indem man mitten auf der Kreuzung neben einem Verkehrspolizisten anhielt, die Scheibe der »Ente« hochklappte und sich höflich erkundigte, wie man am schnellsten an einen bestimmten Ort kommen würde. »Was habt ihr gemacht?«, haben uns ungläubig DDR-Freunde gefragt, als wir ihnen diese Episode erzählten. Unser Verhalten war nach DDR-Regeln ungebührlich. Sie selbst hatten eine andere Praxis verinnerlicht: Auto am Straßenrand abstellen, zu Fuß zum Polizisten gehen und in Demutshaltung um Auskunft bitten oder – falls man etwas falsch gemacht hat – sich einen mündlichen Verweis abholen. Dieses Verhalten war für uns schwer verständlich, weil die »Grünen«, wie man in der DDR Volkspolizisten nannte, in der Gesellschaft eher gering geschätzt wurden. Man machte sich, wie zahlreiche Witze belegen, gern über sie lustig. Frage: Warum treten Volkspolizisten häufig als Paar auf? Antwort: Weil sie nur zu zweien ihre zehn Klassen Oberschule zusammenkriegen. Oder: Was ist, wenn es keine Ökonomen mehr gibt? Dann sind die Volkspolizisten wieder die Dümmsten.
Dass wir in einen Obrigkeitsstaat geraten waren, bei dem sich preußisch-wilhelminische Traditionen mit sozialistischer Bevormundung mischten, haben wir vom ersten Tage an gemerkt. In Gaststätten, wo Gäste am Eingang stehen gelassen wurden, bis ein Kellner nach längerer Wartezeit sie gnädig an einem der vielen freien Tische platzierte. In Kulturhäusern, wo Besucher auf Hinweistafeln ermahnt wurden, in »einwandfreier Kleidung« zu erscheinen. In Rathäusern, wo man vom Pförtner barsch angefahren wurde, wenn man nicht unaufgefordert seinen Ausweis zeigte. Wer ständig nach oben buckeln muss, neigt dazu, andere seine kleine Macht spüren zu lassen. Vielleicht war es ja Zufall, aber Rentner sind uns besonders häufig als Besserwisser und Rechthaber aufgefallen. Irgendwann haben wir mit unseren Kindern in einer Grünanlage gespielt. »Gehen Sie runter, das ist verboten«, herrschten uns Veteranen an, die auf einer Bank saßen. Wir waren in keinem Park mit einem gepflegten Rasen, wo man Einschränkungen akzeptieren konnte, sondern auf einer gewöhnlichen Wiese am Rande des Weißen Sees, nicht weit von unserer Wohnung entfernt. Meine Frau und ich sahen uns an. Als Studenten hatten wir in München erlebt, wie uns berittene Polizisten von den Wiesen des Englischen Gartens vertreiben wollten. Immer wieder hatten wir ihre Aufforderungen ignoriert, bis die kommunale Obrigkeit irgendwann aufgab und uns gewähren ließ. Und jetzt sollten wir uns diesen zänkischen Alten beugen? Wir überhörten ihr Gezeter und spielten weiter mit unseren Kindern.
Читать дальше