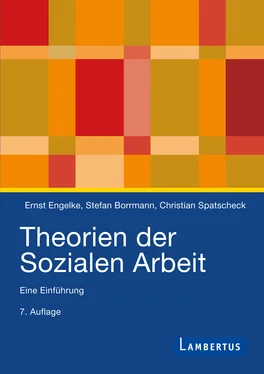„Da die Wissenschaftsentwicklung … wesentlich von der jeweiligen Struktur der kognitiven Gegebenheiten abhängt, dürfen institutionelle, vor allem auch soziokulturelle Bedingungen im Hinblick auf ihre inhaltliche Ausgestaltung nicht vernachlässigt werden. Wissenschaftliche Methoden, Begriffssysteme und Interpretationsschemata unterliegen historischen Veränderungen“ (Mittelstraß 1996, 736). Wissenschaftliche Theorien „fallen nicht vom Himmel“, sondern sind Lebensprodukte.“ … the essence of the history of science is biographical and one wants to know the total person to whom a new theory is due if the genesis of his ideas is to be understood. These ideas do not always arise from objective nature but rather from the idiosyncratic viewpoint of unique individuals” L. Pearce Williams zit. nach Meÿenn 1997, 7). Ein beeindruckendes Beispiel hierfür finden wir bei Sigmund Freud.
Im Mittelpunkt seiner Theorie der Psychoanalyse stand beim jungen, gesunden Freud der Sexualtrieb (libido). Seine Erlebnisse im Ersten Weltkrieg haben ihn erschüttert und ihn die Bedeutung der Aggression erkennen lassen. „Erst das Ausmaß an Zerstörung, wie der Weltkrieg sie mit sich brachte, ließ Freud in der Aggression einen eigenen Trieb, einen Destruktionstrieb, annehmen“ (Wyss 1977, 83). Unter dem Eindruck des Krieges und seiner eigenen Krebserkrankung – der starke Pfeifenraucher Freud wurde über 30 Mal im Mund- und Kieferbereich operiert – widmete sich der alternde Freud ab 1920 verstärkt dem Destruktionstrieb und bezeichnete ihn als Gegenspieler des Sexualtriebs und gab ihm den Namen Todestrieb (thanatos).
Dass auch WissenschaftlerInnen Alltagstheorien entwickeln, die aus den persönlichen Erlebnissen und Erfahrungen ihres alltäglichen Lebens resultieren, ist unseres Erachtens genauso unzweifelhaft wie der Tatbestand, dass wissenschaftliche Theorien mit den Alltagstheorien und den persönlichen Lebenserfahrungen der AutorInnen zusammenhängen. Es wäre zu überprüfen, ob eine sozialwissenschaftliche Theorie letztlich nichts anderes als eine Weiterführung, Vertiefung, Systematisierung und nachprüfbare Begründung des Alltags- und Berufswissens der AutorInnen ist (vgl. Mühlum u. a. 1997).
Aus den genannten Gründen werden wir neben den bei Theoriedarstellungen üblichen Kategorien (Wissenschaftsverständnis, Forschungsgegenstand/-interesse, Inhalt und Bedeutung der Theorie) im Rahmen des hier Möglichen auch den historischen und den biografischen Kontext kurz skizzieren, in dem die Theorien entstanden sind. Eingeleitet wird jede Darstellung mit einem für den Autor/die Autorin unserer Meinung nach charakteristischen Zitat und einer Fotografie des/der Autors/Autorin.
Der Leitfaden , nach dem die einzelnen Theorien vorgestellt werden, besteht aus folgenden Kategorien:
(1) Historischer Kontext: Der zeitgeschichtliche Rahmen der Theorie, die soziokulturellen und ökonomischen Bedingungen, die sozialen Probleme, die vorherrschende Wissenschaftsauffassung. 2
(2) Biografischer Kontext: Wichtige Lebensdaten, soziokulturelle Einbindung sowie Zugang zu Macht und Einfluss.
(3) Forschungsgegenstand und -interesse: Der Gegenstandsbereich, Ziele und erkenntnisleitendes Interesse.
(4) Wissenschaftsverständnis: Das Wirklichkeits- und Wissenschaftsverständnis, die Erkenntnis- und Forschungsmethoden sowie die Denktradition, in der die Theorie steht.
(5) Theorie: Art und Inhalt der Theorie mit den Grundannahmen, Zielen und Werten.
(6) Bedeutung für die Soziale Arbeit: Rezeption, Verbreitung und Einfluss der Theorie zur Zeit der Erstveröffentlichung und heute.
(7) Literaturempfehlungen: Wichtige Publikationen zur Vertiefung der Theorie.
4 Die Auswahl der Theorien und die Gliederung des Buches
Die ausgewählten Theorien werden in vier Gruppen und in der Reihenfolge der Geburtsjahrgänge der AutorInnen dargestellt.
Der erste Teil „Vom Armutsideal bis zum Bauen von Hütten der Liebe“ besteht hauptsächlich aus frühen vorwissenschaftlichen Programmen, Konzepten und Theorien. Sie stehen stellvertretend für verschiedene Arten des Umgangs mit sozialen Problemen (Armut, Krankheit, Behinderung, Alter usw.) in der europäischen Geschichte der Sozialen Arbeit vom 13. bis zum 19. Jahrhundert. Im Mittelalter wurden soziale Probleme vor allem im Rahmen der Theologie und der Philosophie behandelt. Bald danach wurde die Reflexion sozialer Probleme von der Theologie getrennt und erfolgte in anderen, aus der Philosophie sich herausdifferenzierenden und neu gebildeten Wissenschaftsdisziplinen. Diese Entwicklung repräsentieren im ersten Teil des Buches Thomas von Aquin (1224–1274), Juan Luis Vives (1492–1540), Jean-Jacques Rousseau (1712–1778), Johann Heinrich Pestalozzi (1746–1827), Adam Smith (1723–1790), Thomas Robert Malthus (1766–1834) und Johann Hinrich Wichern (1808–1881). Die Rückbesinnung auf die historischen Wurzeln und die damit verbundene historische Vergewisserung, dass Soziale Arbeit als Wissenschaft und Praxis eine lange Tradition hat, können Fixierungen auf Tagesfragen verhindern und das Selbstbewusstsein der Profession stärken.
Der zweite Teil „Von der Gemeinschaftserziehung bis zur Behebung der Not“ enthält Theorien der Sozialen Arbeit aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. In diesem Teil stellen wir bis auf eine Ausnahme nur Theorien aus dem deutschsprachigen Raum dar. Sie zeigen bereits eine deutliche Weiterentwicklung der Sozialen Arbeit als Wissenschaft. Die Theorien sind primär Berufstheorien oder stehen schon als wissenschaftliche Theorie im Zusammenhang mit der Professionalisierung der Sozialen Arbeit und der Ausbildung für die Soziale Arbeit. Die anderen AutorInnen stehen für primär psychologisch, wirtschaftlich, pädagogisch, feministisch, politisch und anthropologisch orientierte Theorieansätze der Sozialen Arbeit. Als RepräsentantInnen haben wir ausgewählt: Paul Natorp (1854–1924), Jane Addams (1860–1935), Christian Jasper Klumker (1868–1942), Alfred Adler (1870–1937), Alice Salomon (1872–1948), Gertrud Bäumer (1873–1954), Ilse von Arlt (1876–1960) und Herman Nohl (1879–1960).
Der dritte Teil „Von der sozial-rassistischen Auslese bis zum gelingenderen Alltag“ enthält Theorien der Sozialen Arbeit aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Diese Theorien erfüllen in etwa die Ansprüche, die heute allgemein an eine wissenschaftliche Theorie gestellt werden. Die ausgewählten Theorien repräsentieren wichtige unterschiedliche wissenschaftstheoretische Ansätze der Theoriebildung und beziehen sich auf den Gegenstandsbereich der Sozialen Arbeit insgesamt und beschränken sich nicht auf Teilgebiete Sozialer Arbeit (z. B. auf Heimerziehung oder Bewährungshilfe). In diesem Teil stellen wir vor: Hans Muthesius (1885–1977), Hans Scherpner (1898–1959), Carel Bailey Germain (1916–1995) mit Alex Gitterman (* 1938), Klaus Mollenhauer (1928–1998), Marianne Hege (* 1931), Lutz Rössner (1932–1995), Karam Khella (* 1934) sowie Hans Thiersch (* 1935).
Der vierte Teil „Vom menschengerechten Handeln bis zur Gerechtigkeit und dem guten Leben” enthält relevante Theorien der Sozialen Arbeit zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Die AutorInnen dieser Theorien befassen sich verstärkt mit den gegenwärtigen Veränderungen der Gesellschaft, die durch Digitalisierung, Automatisierung, Kommerzialisierung, Autonomiestreben, Migration und Individualisierung entstehen und neue soziale Probleme generieren. Die AutorInnen verstehen ihre Theorien ausdrücklich als Theorien der Sozialen Arbeit. Ausgewählt haben wir: Silvia Staub-Bernasconi (* 1936), Lothar Böhnisch (* 1944), Margrit Brückner (* 1946), Bernd Dewe (1950–2017) mit Hans-Uwe Otto (* 1940), Rudolf Leiprecht (* 1955) mit Paul Mecheril (* 1962), Ulrich Deinet (* 1959) mit Christian Reutlinger (* 1971), Björn Kraus (* 1969) und Dieter Röh (* 1971).
Читать дальше