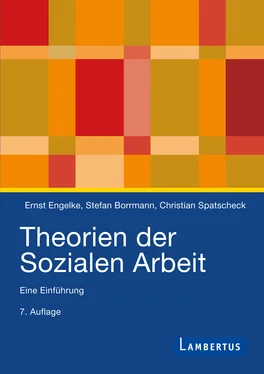„Statt wie die modernen Wissenschaften objektivierende Distanz zu erzeugen, baut sie fiktional zumindest auf bewundernde Unmittelbarkeit und erzieht. Statt eine öffentlich verfahrende moderne Wissenschaft ist die Pädagogik in der Tradition Pestalozzis ein von innen heraus verkündendes Zeugnis. Statt auf Erfahrung, Irrtum und Korrektur setzt sie auf gute Absicht, wiederholten Mißerfolg und Beharrlichkeit“ (Osterwalder 1996, 162).
Auf die Schriften Pestalozzis berufen sich heute viele (Sozial-)PädagogInnen; es dürfte kaum ein anderes pädagogisches Werk geben, das derart ideologisiert und kanonisiert, das heißt jedes historischen Bezuges enthoben worden ist (vgl. Osterwalder 1996). Und es können für kontroverse Auffassungen stützende Passagen in Pestalozzis Schriften gefunden werden. Das umfangreiche und unsystematische Werk Pestalozzis enthält ja selbst zahlreiche Widersprüche: Seine Erziehungsgrundsätze sind einmal patriarchalisch und autoritär, dann wieder partnerschaftlich und liebevoll; sein Denken ist einmal rational aufklärend und dann wieder kindlich gläubig; mitunter revoltiert er gegen den Staat und eine ungerechte Regierung, dann wieder fügt er sich gehorsam in das Machtgefüge ein. Die Begründung von Erziehung aus einer vorgegebenen, alles umfassenden abgeschlossenen Ordnung ist allerdings eine Konstante in Pestalozzis politischem, pädagogischem und religiösem Denken (vgl. a. a. O.). Das sozialreformerisch-sozialpädagogische Engagement Pestalozzis kann heute weiterhin herausfordernd und warnend zugleich wirken. Seine Aussagen über Gesetzgebung und Kindermord bergen auch heute noch politischen Sprengstoff in sich, werden aber – wie viele andere seiner gesellschaftskritischen Äußerungen – nicht zur Kenntnis genommen. Eine Herausforderung für sozial Tätige ist die von Pestalozzi gelebte Verknüpfung von privatem Leben, beruflicher Praxis und Theorie der Sozialen Arbeit. Und eine Warnung ist das Leben Pestalozzis für jeden, der strahlenden Triumph für sich in der Sozialen Arbeit gewinnen möchte, besteht doch Pestalozzis Wirkung vermutlich nicht zuletzt im „Triumph des Scheiterns“ (Albert von Schirnding).
5.7 Literaturempfehlungen
Die kritische Ausgabe von Pestalozzis Werken (Pestalozzi 1927–1996) umfasst 28 Bände; die mehr als 6000 Briefe liegen in 13 Bänden vor. Die Literatur über Pestalozzi und sein Werk füllt ihrerseits viele Bücherwände. Die Biografie von Max Liedtke (Liedtke 1995) führt anschaulich in Pestalozzis Leben und Werk ein; Liedtkes umfassende Bibliografie der Primär- und Sekundärliteratur bietet viele Ansatzmöglichkeiten für ein vertiefendes Studium. Von den Werken Pestalozzis, die allerdings heutigen LeserInnen einiges an Geduld und Toleranz abverlangen, bieten sich die „Abendstunde eines Einsiedlers“ (Pestalozzi 1945, 143–164), „Meine Nachforschungen über den Gang der Natur in der Entwicklung des Menschengeschlechts“ (Pestalozzi 1946a, 377–564), „Über Gesetzgebung und Kindermord“ (Pestalozzi 1945, 353–558) und „Über die Erziehung der armen Landjugend“ (Pestalozzi 1945, 39–76) an, um sich ein eigenes Bild von Pestalozzi und seiner Theorie zu machen. Pestalozzis „Brief an einen Freund über meinen Aufenthalt in Stans“ ist in Auszügen bei Thole/Galuske/Gängler (1998, 43–63) abgedruckt.
6 Das Entstehen von Armut verhindern
Thomas Robert Malthus (1766 – 1834)

„Alles, was ich weiß, ist, dass man keinen schlichteren, tugendhafteren, mehr von häuslichen Neigungen erfüllten Mann in ganz England finden konnte als Malthus und dass sein Herzenswunsch und Arbeitsziel war, häusliche Tugend und Glück in der Reichweite aller zu sehen“ (Harriet Martineau, zit. nach Barth 1977, 197).
Die Bevölkerung in Europa wächst im 18. Jahrhundert rasant (vgl. Schnerb 1983, 19). Der größte Teil der Europäer ist unterernährt und in einem schlechten Gesundheitszustand. Schon eine Missernte reicht aus, dass Tausende von Armen einer Region verhungern müssen. Die verheerenden Wirkungen von Typhus, Pest und Cholera werden durch die unzureichenden hygienischen Verhältnisse in den proletarischen Elendsvierteln sowie durch die Unterernährung und die Kriege gefördert; viele Hunderttausend Menschen werden auch noch im 18. Jahrhundert Opfer dieser Seuchen. Hinzu kommen die Folgen der „industriellen Revolution“, die große Massen von ArbeiterInnen insbesondere in den industriellen Zentren hervorbringen. Diese müssen unter unvorstellbaren Bedingungen ihr Leben fristen.
Als Thomas Robert Malthus geboren wird, hat die lange Regentschaft von König Georg III. (1760–1820) in Großbritannien gerade erst begonnen. Adam Smith ist zu der Zeit Berater des britischen Schatzkanzlers in London; sein Buch über den Wohlstand der Nationen ist noch nicht erschienen. Demokratisierung, Industrialisierung, Agrarrevolution und der Kampf um die Weltmacht mit Frankreich sind die vier großen Herausforderungen, mit denen Großbritannien konfrontiert ist. Die Entwicklung der Naturwissenschaften und der Technik beschleunigt sich und findet einen ersten Höhepunkt. In England ist dieser Prozess am weitesten fortgeschritten. Die alten, arbeitsintensiven Produktionsmethoden (Handwerk, Verlagssystem, Manufaktur usw.) werden durch neue ersetzt (Mechanisierung, maschinelle Massenproduktion usw.). Durch den Einfluss der calvinistischen Ethik wird die Arbeit neu bewertet. Fleiß, Sparsamkeit und nüchternes Gewinnstreben über den Eigenbedarf hinaus gelten als tugendhaft und schaffen die religiös-ethische Basis für eine kapitalistische, an Profitmaximierung orientierte Gesellschaft. Die Gesellschaft spaltet sich in neue Klassen: in Unternehmer (Kapitalisten) und in ungelernte ArbeiterInnen (ProletarierInnen). Ein Überangebot an freigesetzten ArbeiterInnen ermöglicht es den Unternehmern, die Arbeitslöhne und -bedingungen niedrig zu halten. Geringes Einkommen, geschundene Gesundheit, Arbeitslosigkeit und anderes mehr haben erbärmliche Lebensbedingungen zur Folge. Die weitverbreiteten sozialen Missstände führen zu Not und Verelendung weiter Kreise der Bevölkerung; trotzdem wächst die Bevölkerung in Großbritannien ungewöhnlich rasch von 6,3 Millionen Einwohner im Jahre 1750 auf 21 Millionen im Jahre 1850 an. Die Regierung versucht, durch Reformgesetze den sozialen Problemen die Sprengkraft zu nehmen. In den „Fabrikgesetzen“ (1833) werden zum Beispiel die Arbeitsbedingungen und Arbeitszeiten in den Fabriken der verschiedenen Industriezweige geregelt, und in dem „Poor Law Amendment Act“ von 1833 wird die Armengesetzgebung grundlegend reformiert. Die wohlhabenden Mitglieder jeder Gemeinde werden in der Armengesetzgebung verpflichtet, ihren armen Mitmenschen finanziell zu helfen.
Die Französische Revolution mit ihren Zielen Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit löst starke politische Bewegungen in Europa aus, und der Expansionsdrang Frankreichs unter der Herrschaft Napoleons zwingt auch Großbritannien zu Abwehrmaßnahmen, die zu Steuererhöhungen, Getreidesubventionen, Verlust europäischer und überseeischer Märkte führen und dies wieder zu Arbeitslosigkeit und Hungersnöten der Bevölkerung. Neue Staatsideen werden entwickelt, die den Klassenstaat zugunsten von Staatsformen ablösen sollen, in denen das Volk der Souverän ist und ein hohes Maß an gleichen Lebensbedingungen für alle geschaffen wird. In Großbritannien und auf dem europäischen Festland bestimmen die liberalen Thesen von Adam Smith die politische Ökonomie. Die von „Vernunft und Natur“ ausgehenden Ideen der Aufklärung dringen vom europäischen Festland auch nach Großbritannien vor. In Frankreich fordert beispielsweise der Mathematiker und Politiker Jean Marie Condorcet (1743–1794) eine Nationalerziehung zur Beseitigung der Klassenunterschiede im Bildungswesen und eine umfassende Weiterbildung der Erwachsenen. Der Politiker und Schriftsteller William Godwin (1756–1836) macht in England die Forderungen der Französischen Revolution nach Freiheit und Gleichheit für alle Menschen populär und verbreitet sie durch seine viel gelesenen Schriften. So führt Godwin in seinem 1793 erschienenen Werk „An Essay Concerning Political Justice and its Influence on General Virtue and Happiness“ (Eine Untersuchung über die politische Gerechtigkeit und ihren Einfluss auf die allgemeine Tugend und Glückseligkeit) aus, dass die moralischen Qualitäten des Menschen in einem kaum zu überschätzenden Maß das Produkt der Regierungsform und der staatlichen und gesellschaftlichen Einrichtungen seien, weil der menschliche Geist nicht frei, sondern weitgehend durch die sozialen und rechtlichen Verhältnisse und Institutionen bestimmt sei. Auf die Vernunft aller Menschen vertrauend, glaubt Godwin, dass sich eine fast vollkommene soziale Gerechtigkeit für alle Menschen ergeben würde, wenn die politischen Strukturen geändert würden. Außerdem ist für Godwin jedes menschliche Lebewesen mit der Fähigkeit ausgestattet, eine größere Menge von Nahrungsmitteln zu produzieren, als für den eigenen Unterhalt notwendig ist.
Читать дальше