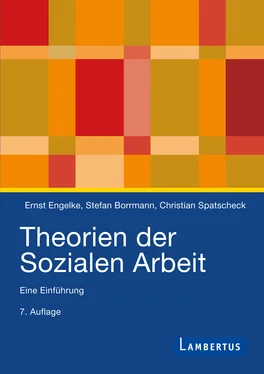Die Erkenntnis, dass alle gesellschaftlichen Beziehungen des Menschen bei seinen familiären Beziehungen anknüpfen und die Familie der ursprüngliche Ort jeder Erziehung ist, führt Pestalozzi dazu, von einer vollständigen Pädagogisierung des Lebens zu sprechen. Die lebenslange Erziehung in allen Lebensbereichen hängt nicht zuletzt damit zusammen, dass nach Pestalozzi jeder Fürst oder Herrscher die Rolle eines Landesvaters innehat (vgl. Liedtke 1989, 67). Pestalozzi ergänzt seine Idee der Volksbildung – im Unterschied zu einer vorherrschenden Gelehrtenbildung in seiner Zeit – mit einer großen Fülle von Überlegungen und Vorschlägen für die Methode des Erziehens, zum Beispiel: Versichere dich des Herzens deines Kindes; das Leben selbst ist das Fundament des Unterrichts; die Menschensprache muss der Büchersprache vorausgehen; die Lernmittel sollen einfach sein; Erziehung muss ohne Härten und Demütigungen erfolgen; die Unterrichtsmethoden sollen spielerisch und kindgerecht sein; je mehr Sinne eine Sache erforschen, desto richtiger wird die Erkenntnis (vgl. Pestalozzi 1946, 241 ff.).
(3) Zum pädagogischen Umgang mit Armen, Verfolgten und Gestrauchelten : Den Begriff „Sozialpädagogik“ kennt und benutzt Pestalozzi nicht, dennoch können seine Ausführungen zum pädagogischen Umgang mit Armen, Verfolgten und Gestrauchelten in einem weiten Sinne als „sozialpädagogisch“ bezeichnet werden. Er plädiert dafür, dass die Pädagogen Anwälte für die Benachteiligten und Randständigen der Gesellschaft sein, emanzipatorisch bilden und von wirtschaftlicher Abhängigkeit befreien, arme Kinder schützen und für diejenigen Partei nehmen sollen, die unter dem Druck der gesellschaftlichen Verhältnisse in Konflikt mit den bestehenden Gesetzen geraten sind. Die Grundzüge seiner „Sozialpädagogik“ hat er vor allem in seinen vielen Briefen (u. a. über seinen Aufenthalt in Stans im Jahre 1799) skizziert:
(a) Den Armen kann nicht geholfen werden, wenn man sie zeitweilig in eine karitative Armenanstalt aufnimmt und sie dann wieder in eine Umwelt entlässt, die völlig anderen Gesetzen unterliegt als der geschützte Raum der Anstalten. So lange zu erwarten ist, dass die Armen nach dem Anstaltsaufenthalt wieder in eine Umwelt zurückkehren müssen, die durch Armut gekennzeichnet ist, kann es nach Auffassung Pestalozzis nur ein taugliches Prinzip für die Armenerziehung geben: „ Der Arme muss zu Armut auferzogen werden “ (Pestalozzi 1945, 39 ff.). Damit will Pestalozzi keinesfalls die Situation der Armen festschreiben. Er ist stark an Verbesserungen interessiert (vgl. a. a. O., 39–93). Dauerhafte Verbesserungen der menschlichen Situation sind aber nur zu erwarten, wenn mit der Verbesserung der äußeren Lebensbedingungen auch eine Verbesserung des Wissensstandes und der Einstellung der Menschen einhergeht. Für Pestalozzi ist es wichtig, dass die jungen Menschen solche Fertigkeiten und Kenntnisse erwerben, die sie in ihrem zukünftigen Leben brauchen, um ihren Lebensunterhalt zu erwirtschaften und diesen abzusichern. Die Armenanstalt soll daher ein möglichst getreues Abbild der künftigen Umwelt der Kinder sein. Selbst der ständige Druck aus der Abhängigkeit von ihren Herren soll den Kindern so früh wie möglich bewusst sein. Sie müssen lernen, sich nach dem Willen anderer zu verhalten. Und die Kinder sollen arbeiten, um dadurch zu ihrem Lebensunterhalt beizutragen. Der Arme müsse lernen, sich selbst zu helfen, da ihm sonst niemand helfen werde. Pestalozzi bedauert die Härte, die seine Theorie mit sich bringt. Aber die „wohltätige“ Erziehung armer Kinder in begüterten Armenanstalten hält er für nachteiliger, weil diese „unglücklichen“ Kinder durch „unweise Wohltätigkeit“ nicht gelernt haben, mit ihrer Armut, der sie ausgesetzt sein werden, zurechtzukommen (a. a. O.).
(b) Pestalozzi greift in seiner Schrift „Über Gesetzgebung und Kindermord“ von 1783 (vgl. a. a. O., 353–558) auch brisante sozialpolitische Probleme, die das Strafrecht , die Strafvollstreckung und die Verbrechensvorbeugung betreffen, auf und ergreift Partei für die ledigen Mütter, die ihr Kind getötet haben . Er verurteilt zwar einerseits die Tötung unehelich geborener Kinder, setzt sich aber andererseits vehement für die ledigen Mütter ein, die ihr unehelich geborenes Kind töten, und nimmt sie vor einseitigen Schuldzuweisungen aus der Gesellschaft in Schutz. Pestalozzi klagt sogar die Obrigkeiten und die Gesetzgebung an und weist ihnen Mitschuld zu. Den Muttertrieb, das eigene Kind zu schützen und es aufzuziehen, hält er für so stark, dass seiner Meinung nach nur erhebliche äußere Einflüsse eine Mutter dazu bringen können, ihr Kind zu töten. Das könne nur aus größter Verzweiflung geschehen. Die bestehenden Gesetze und die Sitten der Gesellschaft – Heuchelei, entehrende und furchterregende Strafen (auf Kindermord steht die Todesstrafe), fehlendes Verständnis für die ledigen Mütter, doppelte Moral, Prüderie, gesellschaftliche Ächtung statt Rat und mangelnde Unterstützung für nichteheliche Mütter – seien, so klagt Pestalozzi, an der Verzweiflung der Frauen mit schuldig. Die Gesellschaft, die sich so unerbittlich als Richter aufführe, sei in Wahrheit selbst angeklagt, zumindest aber mit angeklagt.
Wenn man etwas verbessern wolle, könne man nur bei der allgemeinen gesellschaftlichen Verderbnis ansetzen. Die Bedeutung der Familie müsse anerkannt und das reine Hausglück gefördert werden. Die „Wohnstube“ müsse „Heiligtum“ sein, und dafür solle der Staat sorgen. Vor allem aber müsse sich die Erziehung auf die Familie und die Liebe stützen.
(4) Die Bedeutung prophylaktischen Handelns : Prophylaktische Maßnahmen sind für Pestalozzi unabdingbar, um Elend und Aufruhr der Armen gegen die Obrigkeit zu verhindern. Die zunehmende Verarmung der ländlichen Tagelöhnerschaft und der Industriearbeiter muss nach seiner Einschätzung zu schweren gesellschaftlichen Konflikten führen.
Die „Emporhebung der niederen Menschheit aus ihren Tieffen ist die Pflicht der civilisierten Menschheit, wenn sie nicht alle ihre Lebensgenießungen verlieren will“ (Pestalozzi, zit. nach Liedtke 1989, 58).
Und Pestalozzi fordert:
„Man kann nicht genug sagen: man muss immer eher die Fundamente der Lebensgenießungen sicherstellen, als allerorten Ordnung machen. Und den Leuten in ihren Siechtagen helfen, ist ein armseliger Dienst, wann man den Siechtagen der Leute selber vorbiegen kann. Spitäler, Finderhäuser, Kammern, Zuchthäuser sind allenthalben Quacksalberhülfsmittel, wo man sie gegen Leute braucht, die, von unserer schönen Civilisation der einfachen Genießungen ihrer Naturbedürfnisse beraubt, Verbrecher werden, weil der Staat ihnen nicht Gerechtigkeit widerfahren lassen und zur Befriedigung ihrer Naturbedürfnisse geholfen“ (a. a. O., 58).
Pestalozzi plädiert zudem für eine freiheitliche Wirtschaftsordnung , in der jeder zu seinem Brot kommen kann (vgl. Pestalozzi 1945, 95–141):
„Dass Freiheit Brot schafft, dass der Mensch um des Brotes willen Freiheit sucht, dass Hindernis in Gewinn und Gewerbssachen die Tyrannei ist, die den Wunsch der Freiheit in den meisten Völkern rege gemacht, das vergißt der stolze Großbürger des freien Staats, der den ausartenden Landessegen so oft ausschließend nutzt, nur gar zu gerne, und es ist doch so wahr“ (a. a. O., 107 f.).
5.6 Bedeutung für die Soziale Arbeit
Aus allen Teilen Europas kommen bereits um 1810 zahlreiche BesucherInnen nach Iferten, um Pestalozzis Unterrichtsmethoden kennenzulernen; und die preußische Schulreform wird auf seine Ideen aufgebaut. Fichte, Fröbel, Diesterweg und andere verbreiten seine Thesen zum erziehenden Unterricht und setzen sie in die Tat um. Dann lässt das Interesse allerdings wieder schnell nach, und Pestalozzis Methodik wird sogar als überholt angesehen. Bereits 1846 wird bei der Feier zum 100. Geburtstag Pestalozzis mehr von seiner positiven Wirkung auf die Volksbildung gesprochen als von seinen konkreten Reformideen (vgl. Liedtke 1979, 185). Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wird die sozialpädagogische Bedeutung Pestalozzis wiederentdeckt und hervorgehoben. So befassen sich Paul Natorp (vgl. 2.1) und Herman Nohl (vgl. 2.8) nicht nur ausführlich mit Pestalozzis Schriften, sondern setzen bei ihm mit ihren eigenen Theorien an. Zum 250. Geburtstag Pestalozzis wird für eine Pädagogik, die sich auf Pestalozzi bezieht, festgestellt:
Читать дальше