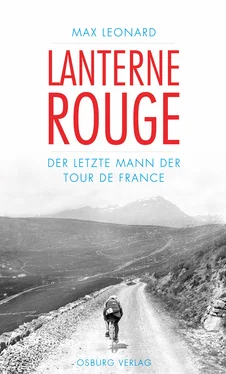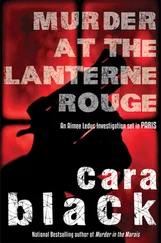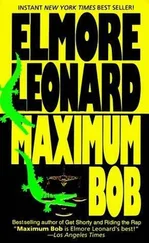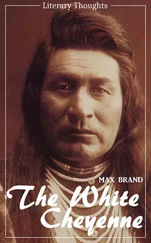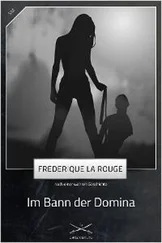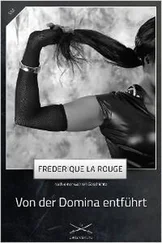Wer als Erster eintrifft, ist der Sieger, wer als Letzter kommt, nimmt den letzten Platz ein. Damit ist das Rennen gelaufen. Wenn der Letztplatzierte am nächsten Tag wieder antritt, so ist das ein Neuanfang: Theoretisch ist er seinen Gegnern wieder gleichgestellt.
Vielleicht ist auch bei den besonders langen Rennen wie der Tour Paris–Brest–Paris der letzte Mann im Peloton schon als lanterne rouge bezeichnet worden. Aber nur bei einem Etappenrennen und nur nach Einführung einer Gesamtwertung konnte es vorkommen, dass ein Fahrer mehrere Tage hintereinander das Schlusslicht bildete. Wenn er als Letztplatzierter ins Bett geht, steht er auch als Letztplatzierter wieder auf, und wenn er sich am nächsten Tag auf sein Fahrrad schwingt, fährt er immer noch auf dem letzten Platz – möglicherweise fast einen ganzen Monat lang. Ich will nicht behaupten, dass die Gesamtwertung mit der Tour de France erfunden wurde, aber sie war meines Wissens das erste Etappenrennen der Welt und erregte in der lokalen, nationalen und internationalen Presse erhebliche Aufmerksamkeit. Nur unter diesen Umständen, so scheint es mir, konnte ein Kult um den Mann aufkommen, der den letzten Platz einnahm.
Nachdem ich die Erwähnung der lanterne im Zusammenhang mit Georges Devilly entdeckt hatte, durchstöberte ich viele der Vorkriegsausgaben von L'Auto, konnte das Zauberwort aber nicht mehr finden. Möglicherweise war es nicht die erste Erwähnung im Druck, aber ich bin mit 1919 sehr zufrieden: Es hat etwas von ausgleichender Gerechtigkeit, dass die rote Laterne im selben Jahr auftaucht, in dem auch (nach offiziellen Berichten) das Gelbe Trikot seinen Einstand gibt.
Damit war das »Wann« mehr oder weniger eingegrenzt. Viel interessanter aber ist das »Warum«. Nach allgemeiner Auffassung wurde die Vorstellung einer lanterne rouge von der Eisenbahn übernommen, bei der am letzten Waggon früher eine rote Laterne hing. Sie sollte Bahnwärtern versichern, dass sich unterwegs keine Waggons gelöst hatten und die Strecke hinter dem Zug frei war: Der Bremswagen mit dem schaukelnden roten Licht war wirklich der letzte Waggon. Eisenbahn- und Autoexperten auf beiden Seiten des Atlantiks haben diese Praxis bestätigt. Offensichtlich war es eine international übliche Vorgehensweise, deren Farbsystem dann auf andere Transportmedien übertragen wurde. Man möchte glauben, dass der Radsport seine Gebräuche eher aus dem Automobilbereich entlehnt hätte, doch angesichts der Entfernungen und Geschwindigkeiten und der Wahrscheinlichkeit von Zusammenstößen mit anderen Objekten (kein Ausweichen möglich!) war die Eisenbahn das erste Transportmittel, bei dem es nötig wurde, allgemeingültige Konventionen einzuführen. Außerdem wurde eine Beleuchtung bei Automobilen erst lange nach dem Ersten Weltkrieg verbindlich vorgeschrieben. Für den Ford T, der seit 1908 gebaut wurde, gab es zwar Öllampen am Heck, allerdings wurden sie erst um 1915 eingeführt. Rot war dank der Eisenbahn lange Zeit die übliche Farbe für die Rücklichter von Autos, allerdings wurde diese Konvention erst mit dem Wiener Übereinkommen für den Straßenverkehr im Jahre 1949 gesetzlich vorgeschrieben.
Rot signalisiert: Halt, nicht anfassen! Das ist ein Beispiel für Aposematismus – eine Warnfärbung, die Gefahr signalisiert, im Grunde genommen das Gegenteil einer Tarnfarbe. Rot hat die größte Wellenlänge im Spektrum des sichtbaren Lichts, weshalb es von Teilchen in der Luft weniger gestreut wird und sich bei Nebel auch auf größere Entfernungen besser ausmachen lässt. Diese Farbe ist schon immer verwendet worden, um Gefahr zu signalisieren. Beispiele dafür sind etwa der Rotschulterstärling, der sein Gefieder zeigt, um Angreifer abzuschrecken, die Korallenschlange und der Pfeilgiftfrosch. Das französische Standardwörterbuch Dictionnaire Le Robert definiert eine lanterne rouge als die Lampe am letzten Fahrzeug eines Konvois. Die Eisenbahn wird nicht ausdrücklich erwähnt, aber Güterzüge scheinen auch eher eine amerikanische als eine französische Idee zu sein. Will man der Darstellung in populären Medien glauben, war der Franzose des fin de siècle eher an Absinth, Kabarett und Madeleines interessiert. Der Robert verweist auch auf die roten Laternen der maisons closes – der Bordelle –, von denen der Begriff des »Rotlichtviertels« abgeleitet ist. Aber das ist eine falsche Spur (oder, um im Bild zu bleiben, ein »red herring«, wie es im Englischen heißt). Radrennfahrer der guten, alten Zeit führten tatsächlich Lampen mit. Graeme Fife, Autor von Büchern wie Tour de France: The History, the Legend, the Rides, erzählte mir von einer Zeichnung in einer Ausgabe der Illustrated London News vom Ende des 19. Jahrhunderts. Darauf sind die Mitglieder eines Clubs zu sehen, die auf einem Sammelsurium von verschiedenen Fahrradmodellen von einem Treffen zurückfahren. Mit den kugelförmigen und zylindrischen chinesischen Papierlaternen, die an Stangen an ihren Fahrrädern befestigt sind, wirken sie wie ein Sanktmartinszug.
Auch die Profis nutzten Lampen, vorzugsweise Öllampen, da viele Rennen der ersten Stunde auch bei Dunkelheit fortgesetzt wurden, wenn sich die Fahrer auf schlechten Straßen abmühten, die verlangten Strecken zurückzulegen. Auch wenn die bildliche Vorstellung gebräuchlich war, ist es unwahrscheinlich, dass der Letzte bei der Tour de France jemals eine rote Laterne führte, unter anderem auch aus logistischen Gründen. Wenn die Tour zu Ende geht, wird dem Letzten jedoch oft eine symbolische Laterne überreicht, gewöhnlich auf der letzten Etappe, wenn nicht mehr genug Luft ist, um seine Platzierung zu verbessern. Fife hat mir auch ein Foto aus den 20er Jahren gezeigt, auf dem zwei Tour-Teilnehmer Seite an Seite radeln. Beide halten einen Stock, an dessen Ende eine Konservendosen-Laterne angebunden ist. Die beiden grinsen breit und ein wenig spitzbübisch, »wie zwei Jungs, die vom Kaulquappenfang nach Hause gehen«, um mit Fife zu sprechen. Diese Dose sieht wirklich wie eine symbolische Laterne aus, was die Vorstellung stützt, dass die lanterne rouge schon in der Frühzeit der Tour ein Preis war, der eine gewisse Selbstkritik und Selbstironie ausdrückte. Noch heute erhält der Letztplatzierte der Tour vor den Champs-Élysées oft eine symbolische Laterne, die entweder von den Pressefotografen oder seinem eigenen Fanclub gestiftet wird. Jedes Jahr tauchen auch einige gestellte Fotos des Fahrers mit der lanterne auf. Manchmal ist er dabei zu sehen, wie er hinter dem Peloton herfährt, sich umdreht und in die Kamera lächelt; manchmal wird ihm die Laterne von anderen Radfahrern überreicht; und manchmal steht er mit einem Fan auf den Champs-Élysées oder bei den Mannschaftsbussen. Diese Fotos zeichnen sich durch gestellte Posen und einen undefinierbaren Ausdruck im Blick des Fahrers aus. Es ist nicht gerade Scham, sondern das ganze Spektrum von amüsiert über verlegen und peinlich bis zu trotzig – das unangenehme Gefühl, bei der Feier des letzten Platzes auf Film festgehalten zu werden. Dafür habe ich nicht mit dem Radsport angefangen!
Aber immerhin sind diese Männer ans Ziel gekommen. Georges Devilly hat es getan, und zwar allein, ohne eine Mannschaft oder wenigstens den Besenwagen als Gesellschaft (der wurde erst 1910 eingeführt). Vielleicht wog er unterwegs ab, was ihn mehr kosten würde – weiterzumachen oder aufzugeben, am Zielort seine Sachen zu packen und sich geschlagen auf den Heimweg zu begeben. Ohne den Gummiengpass wäre er 1919 sogar erneut angetreten.
Devilly und Desgrange hatten mich auf einen langen Umweg geschickt, auf eine Eisenbahnfahrt, zu den Ford-Werken in Michigan, in das zwielichtige Pariser Nachtleben und das Naturkundemuseum. Dabei hatte ich die Tour von 1919 wegen einer Geschichte außerordentlicher Ausdauer recherchiert, bei der ein unwahrscheinlicher Sieger der französischen Nation das Gefühl gab, als hätte sie den Großen Krieg unversehrt überstanden. Also kehrte ich zu dem Jahr zurück, in dem halb Europa die Kosten des Krieges in Form von zerstörten Dörfern und Städten, verwüsteten Feldern, Straßen und Eisenbahnlinien zählte. In Frankreich herrschte eine gequälte und niedergedrückte Stimmung. Fast 2,5 Millionen waren entweder ums Leben gekommen oder als Invaliden heimgekehrt. Unter ihnen waren auch frühere Tourgewinner: Octave Lapize und Lucien Petit-Breton waren tot, desgleichen François Faber, der Luxemburger, der 1909 seiner Konkurrenz davongefahren war. Der Rest des Pelotons war ausgedünnt und hatte sich zerstreut. Außerdem waren die Männer nicht ausreichend in Form. Es war schon schwierig, sie an die Startlinie zu bekommen.
Читать дальше