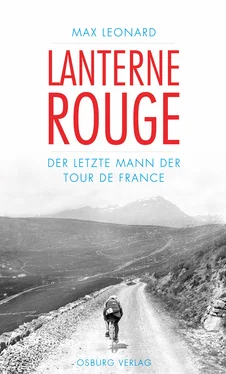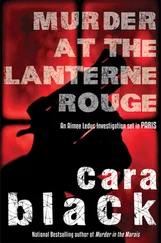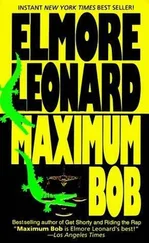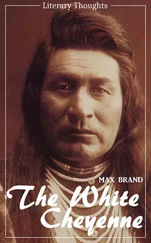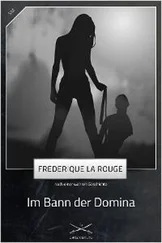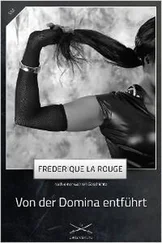1 ...7 8 9 11 12 13 ...16 Die von 1919 sollte ein harter Überlebenskampf werden.
Nachdem er mit dem Krieg, den Herstellern und jeder Art von Güte und Mitgefühl abgerechnet hatte, war Desgrange bereit, das Rennen zu starten. (Er hatte sich 1917 im Alter von 52 Jahren übrigens freiwillig gemeldet und war erst kürzlich aus dem Kriegsdienst entlassen worden.) Gegen die Mitglieder von La Sportive, die »A-Fahrer«, traten die nicht gesponserten Fahrer mit der nicht unbedingt leistungsorientierten Bezeichnung »B« an, die im Grunde genommen den isolés der Vorkriegsjahre entsprachen. Es waren offizielle Preise nur für B-Fahrer ausgelobt, um sie zur Teilnahme zu ermutigen, und ihnen wurde eine Entschädigung von 20 Franc täglich geleistet, doppelt so viel, wie die A-Fahrer bekamen.
Zuerst schrieben sich hauptsächlich B-Fahrer ein, was vielleicht an dem Durcheinander der Sponsorenvereinbarungen für die A-Fahrer lag. Allerdings meldeten sich schließlich alle verbliebenen großen Namen des Radsports und alle aufstrebenden Jungstars an: Odiel Defraye, Eugène Christophe, Firmin Lambot sowie die Brüder Francis und Henri Pélissier, die später die Tour 1924 als Protest gegen Desgranges Despotismus verlassen sollten. Weniger umjubelt war ein gewisser Jules Nempon aus Calais, der sich auch erst kurz vor Toresschluss einschrieb. Vor dem Krieg hatte er sich schon bei einigen kleineren Rennen gut geschlagen und bei den Touren Paris–Le Mans und Paris–Beaugency Plätze unter den ersten Zehn erreicht. Bis zum Ende seiner Karriere sollte er insgesamt zehn Mal bei der Tour de France antreten. Dennoch wurde er zur Kategorie B eingeteilt, was trotz seiner bisherigen Leistungen nicht ungewöhnlich war: Aufgrund des Krieges war die Rennsportkarriere aller Teilnehmer sehr bruchstückhaft.
Am Tag vor dem Beginn des Rennens zeigt die Titelseite von L'Auto ein Gruppenfoto der Tourkandidaten. Genau in der Mitte ist Jules zu sehen, eine Figur wie aus einem Roman von Charles Dickens. Sein Gesicht ist schmal und wird von einer großen, flachen Mütze überschattet, ein kleiner Schnurrbart prangt über seinem schiefen Lächeln, und um seinen Mund ist ein leichter nagetierhafter Zug. Sein Blick hat etwas Melancholisches an sich. Er ist 29 Jahre alt, wiegt 61 kg und fährt ein Rad mit einer »5 m 50 cm«-Übersetzung.11
Insgesamt schrieben sich 130 Fahrer ein, aber nur 69 traten an der Startlinie an, was größtenteils am Reifenmangel lag. Von diesen 69 wiederum schafften es nur 68, von dem feierlichen Start auf der Place de la Concorde in einem Stück zum scharfen Start (départ réel) in Argenteuil zu kommen: Francis Pélissier stürzte während des neutralisierten Starts und brachte zwei Stunden damit zu, sein Rad zu reparieren. Seine Hoffnungen waren schon zunichtegemacht, bevor er auch nur einen Kilometer zurückgelegt hatte. Damit war er sicherlich der Hauptkandidat für die Prämie von 15 Francs, die ehemalige Soldaten in Sainte-Adresse, knapp außerhalb des Etappenziels Le Havre, dem Pechvogel des ersten Tages in Aussicht stellten. Gerade die Soldaten zeigten viel Mitgefühl für die Härten, die die Teilnehmer durchmachten, was möglicherweise daran lag, dass ein Großteil der Radfahrer an ihrer Seite gekämpft hatte. Die Kriegsteilnehmer unter den Radfahrern hatten keine Zeit gehabt, sich nach den fünf Jahren, in denen sie nicht Rad gefahren waren, in Form zu bringen, und es war keine neue Generation junger Radler nachgerückt. All dies trug zu der hohen Ausfallrate bei.
26 Fahrer gaben auf, bevor sie Le Havre erreichten – 18 davon waren B-Fahrer, und insgesamt war dies mehr als ein Drittel des Gesamtfelds. Unter ihnen befand sich sogar der zweimalige Toursieger Philippe Thys, der aufgrund einer Krankheit kurz vor Le Havre aufgeben musste. Jean Rossius, ein belgischer Landsmann, hatte Mitleid mit ihm und ihm etwas zu essen gegeben, wofür er 30 Strafminuten erhielt und damit seinen Vorsprung im Rennen verlor. Jules dagegen war entschlossen, weiterzumachen. Er kam als 20ster am Etappenziel an, ziemlich am Ende des Feldes. Allerdings war er der Erste von allen B-Fahrern.
Während der dreitägigen Fahrt entlang der Nordküste von Paris über Le Havre und Cherbourg nach Brest stürmte Gegenwind auf die Fahrer ein. Unter dem Eindruck, die ganze Welt habe sich gegen sie verschworen, gaben die gefeierten Gebrüder Pélissier in Brest im strömenden Regen auf. Auf dieser Etappe bildete Henri Leclerc das Schlusslicht. Er kam erst gegen Mitternacht ans Ziel und verbrachte seinen ganzen Ruhetag im Bett. Auf 200 der 412 km der nächsten Etappe blieb Nempon spielend in der Spitzengruppe, weshalb ein Korrespondent ihn zu einem todsicheren Tipp für die Kategorie B erklärte und begeistert ausrief: »Meiner Treu, ich gewahrte ihn in hervorragender Kondition!« Nempon ging jedoch schließlich als Letzer ins Ziel, zuvor war er allerdings drei Stunden lang Alois Verstraeten voraus gewesen, seinem nächsten Rivalen der Kategorie B.
Am Fuß der Pyrenäen, die die Fahrer nach zwei endlos langen Etappen entlang der Atlantikküste erreichten, hatten das furchtbare Wetter und der unmögliche Straßenzustand das Feld auf nur noch 25 Mann ausgedünnt, ein Drittel derjenigen, die in Paris aufgebrochen waren. Géo Lefèvre erklärte dies zur »schönsten Tour de France, die ich je gesehen habe«. Seine Reportagen waren anzüglich und sadistisch, und er übertrieb bewusst die Dramen, die sich auf der Straße abspielten. Viele der klassischen Bilder von Leid, Ausdauer und Entschlossenheit, die unser Bild der Tour prägen, nahmen mit der Berichterstattung über diese Tour ihren Anfang – die hohlwangigen Gesichter, die schweißüberströmten Brauen, die angespannten Muskel und der Ausdruck von tiefster Erschütterung –, um die Taten der »Giganten der Straße« noch heldenhafter erscheinen zu lassen. Lefèvres Sadismus war jedoch nicht ohne Bewunderung und sogar ein gewisses Mitleid. Wie Christopher S. Thompson, der Autor von The Tour de France: a Cultural History, es formulierte, entwickelte sich um diese extrem harten Touren ein »Überlebenskult«. Wer wie Nempon eine gewisse Selbstgenügsamkeit und Leidensfähigkeit bewies, wurde gefeiert, welchen Platz er auch immer einnahm. Man jubelte diesen Menschen wegen ihrer Haltung, ihrer Würde und ihrer Entschlossenheit angesichts der strapaziösen Herausforderungen zu.
Während der nächsten beiden Etappen ließ Nempon nach, während Verstraeten sich erholte, sodass für Jules die Gefahr bestand, überholt zu werden. Vor der Tour hatte L'Auto ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den französischen Schwergewichten in Aussicht gestellt – mit Eugène Christophe, Jean Alavoine und den Pélissiers gegen Firmin Lambot, Émile Masson und die Buysse-Brüder – und nun entpuppte sich das Ganze als Sturm im Wasserglas. Es waren nur noch 17 Teilnehmer übrig. »Der kleine Fahrer aus Calais scheint zu ermattet zu sein, um sich den zahlreichen Schwierigkeiten zu stellen, die seiner noch harren«, schrieb Lefèvre.
In den Pyrenäen begann Nempon wieder zu kämpfen. Die erste Etappe von Bayonne nach Luchon enthielt einige der berühmtesten Anstiege der Tour: Aubisque, Tourmalet, Aspin und Peyresourde. 1919 gab es in den höheren Regionen dieser Berge kaum mehr als Trampelpfade. »Unsere Männer fluchen auf den endlosen Anstiegen über die ›Sträflingsarbeit‹, halten die Hände fest am Lenker und treten kräftig in die Pedale. Am blauen Horizont an der Spitze des Col erscheinen sie als Schattenrisse, ihre Körper vornübergebeugt«, schrieb Desgrange, »und dann tauchten sie, so schien es, ins Nichts ab. In der Zeit, die wir brauchten, um zum Gipfel zu gelangen, waren sie bereits zu winzigen Punkten geschrumpft, die auf der weißen Straße zum Golf unter uns hinabrollten.« Nempon flog förmlich über die Berge und überquerte den Portet d'Aspet und den Col de Port in der führenden Dreiergruppe. Obwohl er stürzte und mehrmals einen Platten hatte, nahm sein Selbstvertrauen wieder zu. Verstraeten dagegen stürzte nach einem Start um 2 Uhr nachts in der Dunkelheit. Arg mitgenommen und blutig geschlagen humpelte er weiter.
Читать дальше