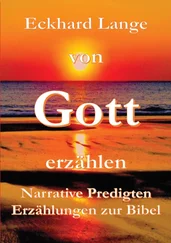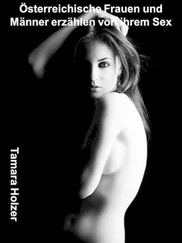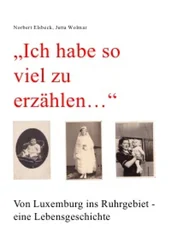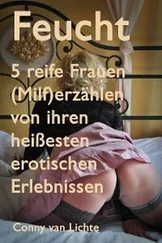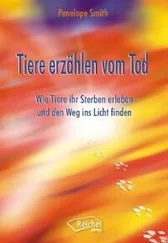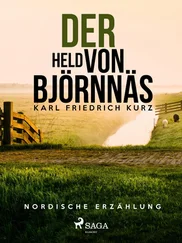An die Diskussion zum identitätsstiftenden Geschichte-Erzählen knüpft Cordula Kropik (Basel) an, indem sie am Beispiel spätmittelalterlicher Sängererzählungen die Interferenz von Helden- und Dichtersage verfolgt. Dabei begnügt sie sich mit Recht nicht mit dem herkömmlichen Verständnis, wonach die Dichtungen eine anachronistische Tradition der deutschen Literatur ‚erfinden‘. Stattdessen erweist sich die narrativ hergestellte Konstruktion einer kulturellen Identität volkssprachlicher Dichter als eine Form von ‚ästhetischem Gedächtnis‘. Julia Frick (Zürich) konzentriert sich auf ein aspektreiches Fallbeispiel aus dem späten Mittelalter, den Trienter Judenprozess, der als zeitgenössisches Ereignis im 15. Jahrhundert literarisch verarbeitet und im Druck verbreitet wurde. In eingehenden Vergleichen der lateinischen und volkssprachigen Textzeugnisse arbeitet sie die hochgradig parteiliche Narrativierung des Prozesses heraus und weist so die narrativ-diskursiven Muster nach, die den Umgang mit den historischen Fakten prägen.
Grundmuster des historischen Erzählens werden im abschließenden Themenblock aus geschichtswissenschaftlicher und literaturwissenschaftlicher Perspektive kritisch hinterfragt. Aus der differenzierten Perspektive des Historikers fragt Len Scales nach Kennzeichen des ‚staufischen Zeitalters‘ und führt – ausgehend von Beobachtungen zur Stuttgarter Ausstellung Die Zeit der Staufer im Jahre 1977 – in souveräner Weise vor, dass mittelalterliche Zeitgenossen eine als ‚staufisch‘ wahrgenommene dynastische, politische, künstlerische oder literarische Tradition nicht kannten. Der Beitrag, der auf einen öffentlichen Abendvortrag im Historischen Lesesaal der John Rylands Library zurückgeht, verdeutlicht überzeugend, unter welchen speziellen Umständen die Vorstellung eines ‚staufischen Zeitalters‘ überhaupt aufgekommen ist.
Abgerundet wird der Band durch zwei Fallstudien zu den römisch-deutschen Herrschern des Spätmittelalters. Anne Simon (London) geht es mit Blick auf die geschichtliche Rolle Karls IV. um die Chronistik und Memorial-Architektur in der Reichsstadt Nürnberg vom späten 14. bis frühen 16. Jahrhundert. In der Stadtchronik Sigmund Meisterlins wie auch der Weltchronik Hartmann Schedels lassen sich exemplarisch an die imperiale Macht angelehnte Strategien reichsstädtischer Selbstlegitimierung – Gründungsnarrative ebenso wie Erzählungen von der Promulgation der Goldenen Bulle (1356) und der Überführung der Reichskleinodien (1424) – beobachten. Eine Entsprechung finden diese Strategien in der baulichen Inszenierung des Schönen Brunnens als Erinnerungsort von Herrschaft und in dem Ritual des Männleinlaufens , das an die Huldigung Karls IV. durch die deutschen Kurfürsten erinnert. Stefan Matter (Fribourg) erläutert anhand eines aus 203 Zeichnungen bestehenden Konvoluts in Washington DC die Entstehungsumstände von Kaiser Maximilians Freydal ; bisher als Nachzeichnungen verkannt, erweisen sich die Washingtoner Illustrationen tatsächlich als Vorarbeiten und gewähren einen Einblick in die literarisch-künstlerische Aufarbeitung der Karriere Maximilians als Ritter. Dabei wird der Fokus nicht auf die narrativen Erzählung jener Karriere gerichtet – es fehlen alle Angaben zu den ‚historischen‘ Umständen der Turnierkämpfe –, sondern allein auf die Kleidung des Kaisers und auf den Ausgang der Kämpfe gegen die mit Namen versehenen, jedoch nicht individuell gestalteten Gegner. Die Geschichtskonzeption des Freydal lässt damit historisch verbürgte Vorstellungen der Prachtentfaltung und Majestät Maximilians erkennen.
Den wissenschaftlichen Ertrag des Tagungsbandes resümiert Almut Suerbaum (Oxford) in einem prägnanten Fazit. Die zentralen Ergebnisse der Tagung lassen sich in drei Punkten zusammenfassen. Erstens haben die Beiträge zur Kaiserchronik die Faszination des frühen Hochmittelalters in Erinnerung gerufen, doch zugleich auch die Pole markiert, zwischen denen sich das Erzählen von Geschichte erfassen lässt: Auf der einen Seite ist nicht Chronologie, sondern ‚Bedeutsamkeit‘ die zentrale Kategorie für das volkssprachliche Geschichte-Erzählen; auf der anderen Seite hat sich gezeigt, welche Bedeutung gerade Formen von Serialität und Wiederholung haben. Zweitens hat eine Reihe der Beiträge demonstriert, dass Geschichte an Ordnungsstrategien gebunden ist, die es erlauben, aus der unbegrenzten Fülle des Materials auszuwählen und das Ausgewählte zu ordnen, was immer auch die Reflexion über Zeit und Zeitlichkeit in der Geschichte verlangt. Die Auseinandersetzung mit dem Mittelalter lehrt also, dass unsere heutigen Konzeptionen von Zeit der Historisierung bedürfen. Drittens haben die Beiträge entschieden einem differenzierteren Blick auf den Status der Volkssprache und volkssprachlichen Literatur zugearbeitet. Deutlich wurde, wie man über den oftmals vagen Begriff des Hybriden hinauskommt, indem man das Zusammenspiel unterschiedlicher Erzähltraditionen präzise beobachtet und beschreibt. Volkssprachliches historisches Erzählen versteht sich einerseits als Fortsetzung der gelehrten Tradition, etwa wenn es sich explizit auf lateinische Quellen beruft. Andererseits gibt es nicht wenige Fälle, in den sich Texte als expliziter Neubeginn verstehen, an volkssprachige Traditionen anschließen, ihre Distanz zu anderen Traditionen markieren und sich auf weltliche wie geistliche Gründerfiguren berufen, um die eigene Tradition zu rechtfertigen oder erst selbst zu stiften.
Die Tagung in Manchester hatte es sich zum Ziel gesetzt, die Darstellung von Geschichte in der deutschen Literatur des Mittelalters auf der Basis von Forschungen zur narrativen Modellierung der als wahr geglaubten vergangenen Welt zu bilanzieren und mit dem Blick auf aktuelle wissenschaftliche Aufgabenfelder neu zu erarbeiten. Diese ambitionierte Zielsetzung können naturgemäß auch die Beiträge des Tagungsbandes nicht in jeder Hinsicht einlösen, doch fördern sie, so ist zu hoffen, das Potential des Themas exemplarisch zutage. Daraus dürfte der Impuls resultieren, künftig verstärkt an narratologische Forschungen anzuschließen, wenn es zu verstehen gilt, wie Geschichte aus dem Erzählen von Vergangenheit hervorgeht.
Die Kaiserchronik als Paradigma
Die drei Fassungen der Kaiserchronik in der Überlieferung am Beispiel von Tarquinius und Lucretia
Mark Chinca, Helen Hunter und Christopher Young
Kaum ein anderes Werk des deutschen Mittelalters eignet sich für eine Untersuchung der Narrativierungsstrategien von Erzähltexten so wie die um 1150 vermutlich in Regensburg verfasste Kaiserchronik , die bereits im neunzehnten Jahrhundert als wichtiges Zeugnis der frühmittelhochdeutschen Literatur galt, allerdings zeitweise durch eine Privilegierung der kurz darauffolgenden Blütezeit ins Abseits geriet, und erst im letzten Jahrzehnt wieder intensiver in den Fokus der Forschung gelangt ist.1 Mit ihren knapp 17.000 Versen, die Legende und Sage mit eigener moralischer Pointierung zusammenflechten, schildert sie in einer Abfolge von 55 Herrschern die Geschichte des römisch-deutschen Reichs von Cäsar bis Konrad III. und stellt somit ein außerordentliches Monument der Literaturgeschichte dar. Sie ist die erste volkssprachliche Chronik Europas in Reimpaarversen, das erste Großwerk der frühmittelhochdeutschen Periode überhaupt, und enthält u.a. die erste ausformulierte Lebensgeschichte Karls des Großen in deutscher Sprache.2 Wer also erschließen möchte, was ein Laienpublikum des 12. Jahrhunderts über die Frühgeschichte des Heiligen Römischen Reiches wusste oder hörte, begegnet in diesem Text einer Vielzahl von Spuren und Belegen.
Dem Werk war offenbar ein großer Erfolg beschieden. Binnen hundert Jahren nach seiner Entstehung wurde es bekanntlich zweimal überarbeitet: zunächst um 1200, als der höfische Roman sich entfaltete und auf seinen Höhepunkt zuging; und nochmals 50 Jahre später, zu einer Zeit, als der Weltchronistik eine immer bedeutendere Rolle zukam. Diese jüngeren Fassungen (B und C genannt) wurden wohl in Unkenntnis voneinander unternommen und sind als völlig unabhängige Bearbeitungen zu verstehen. Dass es beiden Bearbeitern in erster Linie um eine formale ‚Modernisierung‘ des alten Textes ging, d.h. um reine Reime und metrischen Ausgleich, die den als altertümlich und nicht mehr zeitgemäß empfundenen frühmhd. Text der inzwischen etablierten poetischen Norm des paargereimten Vierhebers anpassen sollte, gilt längst als Gemeingut der Forschung. Die C-Fassung erhielt außerdem einen neuen Prolog und wurde durch zwei Fortsetzungen ausgeweitet (die sogenannte ‚bairische‘ und die sogenannte ‚schwäbische‘), die jeweils die Ereignisse aus der deutschen Reichsgeschichte bis zum Jahr 1250 erzählen und den Bericht bis zum Jahr 1278 weiterführen.
Читать дальше