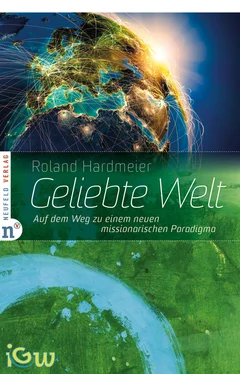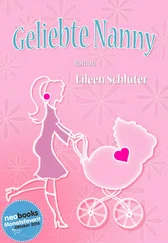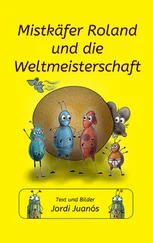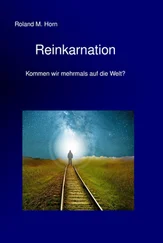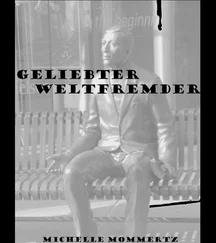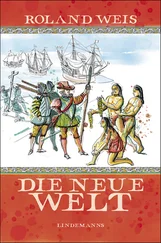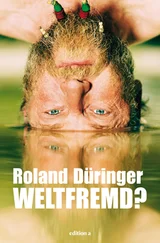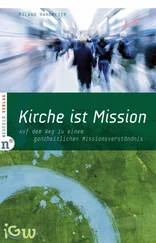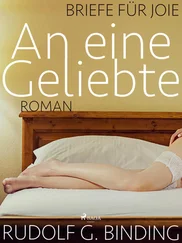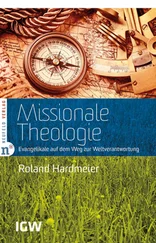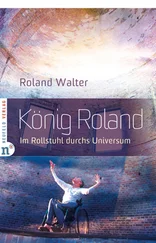1 ...6 7 8 10 11 12 ...17 Es ist hohe Zeit, das Wohlstandsmodell der Industriemoderne auf den Prüfstand zu stellen. Mehr Gerechtigkeit in dieser Welt ist auf dem Verbrauchsniveau der Industrieländer nicht zu erreichen. Eine Wirtschaftsentwicklung konventionellen Stils, die einer wachsenden Weltbevölkerung insgesamt einen westlichen Lebensstandard bescheren möchte, wird ökologisch nicht durchzuhalten sein. (Sachs & Santarius 2005, 44)
In der modernen Wirtschaftsgeschichte ging man bisher davon aus, dass Wachstum mehr Wohlstand für alle bedeute.
Bei wirtschaftlichem Aufstieg werde sich darum – so die geläufige Antwort – die Frage der Gerechtigkeit auf Dauer von selber lösen. Diese Ankoppelung von Gerechtigkeit an wirtschaftlichem Wachstum war nach dem Zweiten Weltkrieg zum konzeptuellen Eckstein des Entwicklungszeitalters geworden. Seit jedoch die Endlichkeit der Biosphäre zutage tritt, also seit wenigen Jahrzehnten, steht dieser Eckstein auf schwankendem Boden. In einem begrenzten Umweltraum kann konventionelles Wachstum keine Gerechtigkeit mehr schaffen – es sei denn um den Preis einer zerrütteten Biosphäre (Sachs & Santarius 2005, 41).
Was bedeutet es angesichts des Klimawandels, dass Christen das Salz der Erde und das Licht der Welt sein sollten?
Es steht außer Zweifel, dass das Überleben der Menschheit einen nachhaltigen Lebensstil verlangt. So wichtig das Thema des einfachen Lebensstils ist, so ist doch klar, dass mit Genügsamkeit allein das Klima nicht zu retten ist. Unternehmen, Institutionen und Individuen müssen eine nachhaltige Existenz anstreben. Die Evangelikalen sollten daran arbeiten, dass dies eine ihrer Kernkompetenzen im 21. Jahrhundert wird. Dazu müssten sie eine biblisch fundierte Theologie der Welt entwickeln, welche eine Theologie der Ökologie einschließt. Diese Theologie der Ökologie hätte eine dreifache Aufgabe:
Erstens müsste sie biblisch fundiert sein und sich nicht dem theologischen Liberalismus anbiedern. Eine Theologie der Ökologie darf nicht auf Kosten der Evangelisation oder der Jüngerschaft gehen. Es kann nicht darum gehen, eine Einnivellierung des biblischen Evangeliums mit liberalen Theologien zu erreichen. Es muss vielmehr um die Ganzheitlichkeit der Guten Nachricht gehen, die eben nicht nur die Seele des Menschen und sein ewiges Heil betrifft, sondern auch den natürlichen Lebensraum des Menschen als von Gott geliebte Welt. Die Theologie der Ökologie müsste bei der Schöpfung in Gen 1 ansetzen und nicht erst beim Sündenfall in Gen 3 (Gnanakan 1999, 40–41).
Zweitens müsste die zu entwickelnde Theologie der Ökologie in den Sendungsauftrag der Kirche integriert werden. Es müsste klar werden, dass es beim Umweltbewusstsein nicht um ein Lieblingsthema einiger grün angehauchter Nachfolger von Jesus geht, sondern dass die Umwelt die Kirche als Ganzes angeht. Auf diese Weise würde die Kirche ernst damit machen, dass sie in dieser Welt existiert, dass sie mit dieser Welt auf Gedeih und Verderb verbunden ist und dass Gott sein Heil in dieser Welt verwirklichen will. Ökologisches Bewusstsein müsste konkret in das evangelikale Missionsverständnis eingebunden werden und den richtigen Platz zugewiesen bekommen.
Drittens müsste eine evangelikale Theologie der Ökologie konkrete Handlungsanweisungen für einen nachhaltigen Lebensstil enthalten. Das würde bedeuten, dass der nachhaltige Lebensstil ein Thema der Jüngerschaft und der Heiligung wird. Es würde um nichts weniger als eine weltliche Heiligkeit gehen. Die Kirche könnte eine Senfkornrevolution in Gang setzen, wenn es ihr gelänge, mit ihren Mitgliedern einen nachhaltigen, den Frieden fördernden und sozial gerechten Lebensstil zu entwickeln. Das eine wird in Zukunft ohne das andere nicht zu haben sein.
Evangelikale auf dem Weg zu einem neuen missionarischen Paradigma
Zweifellos: Die Evangelikalen befinden sich auf dem Weg zu einem neuen missionarischen Paradigma. Doch was ist unter einem Paradigma zu verstehen und wie findet ein Paradigmenwechsel statt?
Ein Paradigma ist nach der Definition des Wissenschaftstheoretikers Thomas S. Kuhn eine Gesamtkonstellation von Überzeugungen, Werten und Verfahrensweisen, die von den Mitgliedern einer bestimmten Gemeinschaft geteilt werden (Küng 1999, 145). Kuhn schlägt vor, dass die wissenschaftliche Erkenntnis sich nicht kumulativ verändert, also nicht dadurch zu neuen Erkenntnissen zur Lösung eines Problems gelangt, indem sie immer auf alten Erkenntnissen aufbaut, sondern dadurch, dass sich neue Erkenntnisse durch Revolutionen Bahn brechen. So bewerten etwa einige wenige Wissenschafter ein Problem oder eine Fragestellung qualitativ anders als dies gemeinhin der Fall ist. Sie suchen nach einer neuen Lösung, nach neuen Denk- und Verfahrensweisen und geben so den Anstoß zu einem neuen Paradigma (Bosch 1991, 183–185).
Der katholische Theologe Hans Küng wendet in seinem Buch Das Christentum Kuhns Paradigmentheorie auf die Kirchengeschichte an und zeigt auf, wie sich in einem langen Prozess verschiedene kirchliche Paradigmen entwickelten. Er unterscheidet 6 Paradigmen:
1. Das urchristlich-apokalyptische Paradigma des 1. Jahrhunderts unserer Zeitrechnung, welches die Zeit des Neuen Testamentes und die nachapostolische Periode umfasst .
2. Das altkirchlich-hellenistische Paradigma der frühen Kirche, das sich bis in die frühmittelalterliche Zeit erstreckte und durch den Frühkatholizismus und die Kirchenväter geprägt war .
3. Das mittelalterlich-römisch-katholische Paradigma, das bis zum Anbruch der Reformation galt und durch das Papsttum, die Machtentfaltung der katholischen Kirche und die scholastische Theologie dominiert war .
4. Das reformatorisch-protestantische Paradigma, das mit der Reformation einsetzte und sich auf die unbedingte Autorität der Bibel als Wort Gottes berief .
5. Das aufgeklärt-moderne Paradigma, welches mit der Aufklärung einsetzte, durch Vernunftdenken und Fortschrittsglaube charakterisiert war und die liberale Theologie hervorbrachte .
6. Das zeitgenössisch-ökumenische Paradigma, dessen Beginn auf die Mitte des 20. Jahrhunderts anzusetzen ist .
Küngs Modell ist aus mehreren Gründen hilfreich: Es ermöglicht die Darstellung einer geschichtlichen und theologischen Entwicklung, ohne bereits Urteile über die Richtigkeit dieser Entwicklung zu fällen. Die unvoreingenommene Beschäftigung mit der Kirche wird dadurch erleichtert. Es ermöglicht, die grundlegenden Konstanten und die entscheidenden Variablen der unterschiedlichen Paradigmen herauszuarbeiten. Und es ermöglicht die Wahrnehmung des kontextuellen Charakters eines bestimmten Paradigmas, indem die theologischen Entwicklungen in ihrem geschichtlichen Kontext erfasst werden (Küng 1999, 90).
Ein Paradigma ist kirchengeschichtlich gesehen eine umfassende theologische Überzeugung, welche eine bestimmte Weltauffassung als Grundlage und zur Folge hat. Küng (1994, 90) spricht auch von einer „epochalen Gesamtkonstellation“, welche ein Paradigma ausmacht. Zweifellos existieren verschiedene Mikroparadigmen zur selben Zeit. Sie können sich voneinander unterscheiden oder zusammen zu einem Makroparadigma beitragen (Küng bezeichnet die von ihm unterschiedenen Paradigmen als Makroparadigmen).
Beleuchtet man die evangelikale Theologie durch Küngs Brille, kann gesagt werden: Der Evangelikalismus bildet ein selbstständiges Mikroparadigma, das Gemeinsamkeiten und Unterschiede mit den von Küng identifizierten Paradigmen aufweist. Die evangelikale Bewegung ist stark vom reformatorischen Paradigma geprägt. Der Evangelikalismus fußt auf der reformatorischen Vorrangstellung der Heiligen Schrift. Das Verhältnis zum Paradigma der Aufklärung ist distanzierter. Der Evangelikalismus unterscheidet sich insofern vom Vernunftdenken, als er sich erfolgreich gegen die liberalen Auswüchse einer aufgeklärten Theologie stemmte. Übernommen wurde der Fortschrittsglaube, der sich im 19. Jahrhundert in der Überzeugung niederschlug, das Evangelium habe einen weltweiten Siegeszug angetreten. Diese Fortschrittsgläubigkeit wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts durch eine pessimistische Eschatologie gebrochen und durch die beiden Weltkriege nachhaltig erschüttert. Wesentliche Elemente des reformatorisch-protestantischen und des aufgeklärt-modernen Paradigmas sind vom Evangelikalismus also aufgenommen worden und werden ihn weiterhin prägen. Parallel dazu deuten einige grundlegende Veränderungen, in denen sich der Evangelikalismus gegenwärtig befindet, den Eintritt in ein neues Paradigma an. Die These dieses Buch ist: Die evangelikale Missionstheologie befindet sich gegenwärtig im Übergang vom eurozentrisch-kolonialen Paradigma des Aufklärungszeitalters zum missional-ganzheitlichen Paradigma der Postmoderne . Ich werde den verbleibenden Platz in diesem Kapitel darauf verwenden das Charakteristische an diesem postulierten Umbruch zu skizzieren.
Читать дальше