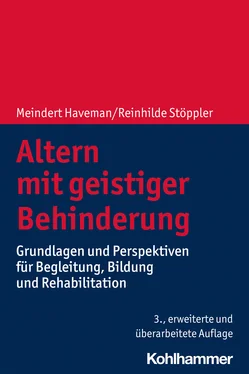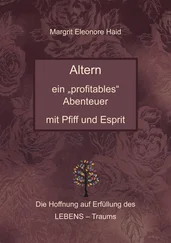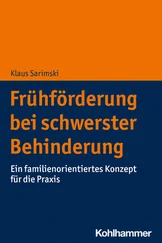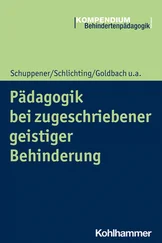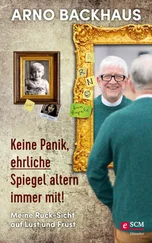Die dritte Ursache für die Deinstitutionalisierung war die Hoffnung auf Kostensenkung, da die institutionelle Pflege als teuer angesehen wurde (Chow & Priebe, 2013; Parker, 2014). In ihrem Review über Untersuchungen beschreiben Brennenwold et al. (2018) sowohl positive als auch negative Resultate der Deinstitutionalisierung von psychiatrischen Einrichtungen und Wohneinrichtungen für Menschen mit geistiger Behinderung. Da eine Differenzierung nach Alter fehlt und die Ausführungen im vorliegenden Kontext zu weit führen würde, wird an dieser Stelle auf diese Übersichtsstudie lediglich verwiesen.
Aktuell ist Deinstitutionalisierung eine sozialpolitische Forderung der EU in Richtung der neuen Mitgliedstaaten. Obwohl die Entwicklung von gemeindeorientierten Einrichtungen voranschreitet, bleibt in vielen Ländern, z. B. Deutschland, weiterhin die Möglichkeit bestehen, in größeren Wohnformen zu leben. Die Öffnung und Eingliederung der Bewohner in kleinere Wohneinheiten nimmt zu. Es entstehen ebenfalls Modelle zentraler Einrichtungen mit vielen kleinen gemeindenahen Wohnungen.
Im angelsächsischen Modell (Kanada, USA, Großbritannien, Australien) ist die Entwicklung der Lebensbereiche alter Menschen mit geistiger Behinderung stark an das Paradigma des Normalisierungsprinzips und der Deinstitutionalisierung gebunden. Einerseits bedeutet dies, dass große Wohneinrichtungen geschlossen wurden, andererseits, dass die älteren Menschen nicht immer in qualitativ geeigneten alternativen Wohnformen (u. a. Pflegeheime) aufgenommen wurden.
3.2 Normalisierungsprinzip
Das Normalisierungsprinzip wurde durch Nirje (1969, 1972) und Bank-Mikkelsen (1980) in Skandinavien eingeführt und fand durch Wolfensberger (1972) in den USA große Verbreitung. Das Streben nach Normalisierung präsentierte sich in Form einer Bürgerrechtsbewegung, als eine Reaktion gegen große Einrichtungen, in denen seit dem 19. Jahrhundert Menschen mit geistiger Behinderung und psychischen Störungen abgeschirmt von der Gesellschaft in oft erbärmlichen Zuständen lebten. Die Lebensbedingungen waren für diese Bewohner nicht nur inhuman, sondern auch nicht »normal« im Vergleich mit dem Leben außerhalb dieser Einrichtungen. Nirje betonte die Relevanz, den Menschen mit geistiger Behinderung einen »normalen Lebensrhythmus« zu ermöglichen und bedeutungsvolle Aspekte, wie Wohnen, Freizeit und Arbeit, als separate Lebensbereiche zu gestalten. In seinem späteren Werk arbeitet Nirje (1994) diese Gedanken weiter aus und formuliert das Recht des Menschen mit geistiger Behinderung auf einen normalen Tages-, Wochen- und Jahresrhythmus, auf normale Entwicklungserfahrungen während der Lebensspanne, auf die Respektierung von Wahlmöglichkeiten, Wünschen und Bedürfnissen, auf eine zweigeschlechtliche Lebenswelt, auf ein Leben unter normalen ökonomischen Standards und auf Wohnen in einer normalen Wohnung und Nachbarschaft.
Diese Forderungen führten in vielen europäischen Ländern und in Nordamerika zu einer progressiven Politik der Enthospitalisierung und Deinstitutionalisierung. Wolfensberger und Thomas (1980) haben in den USA das Normalisierungsprinzip modifiziert und als Social Role Valorization Theory konzipiert. Bei dieser Theorie liegt der Fokus auf dem Gebrauch von kulturell positiv bewerteten Mitteln (Gesetzgebung, mediale Darstellung, usw.), wodurch es für Menschen mit Behinderungen möglich wird, als respektierter Bürger zu leben und nicht in einer sozialen Umwelt mit negativen Rollenerwartungen aufzuwachsen. Eine Strategie, zur Erreichung dieses Ziels, ist das Vermindern von Stigmata. Die andere Strategie besteht in der Veränderung von Auffassungen und Attitüden in der Bevölkerung durch die positive Bewertung von bisher eher negativ bewerteten Menschen mit Behinderungen (revaluing of »devalued« people).
Der Begriff der Sozialen Integration ist historisch verknüpft mit dem Konzept der Aussonderung, der separaten Bildung und der institutionellen Gestaltung der Lebensbereiche Arbeit, Freizeit, Wohnen sowie der medizinischen und pflegerischen Versorgung und Begleitung. Als Gegenbegriff wurde um 1980 der Begriff der Nichtaussonderung in die Debatte eingebracht (Schildmann, 1996). Man unterscheidet dabei physische Integration (gleichberechtigte Teilhabe/Teilnahme von Menschen mit Behinderung in der Mitte und geographischer Nähe von nichtbehinderten Menschen), funktionale Integration (gleichberechtigte Teilhabe/Teilnahme an allen Institutionen und Organisationen des öffentlichen Lebens) und soziale Integration (Akzeptanz des behinderten Menschen als vollwertiger Bürger der Gesellschaft).
Der Begriff der Integration hat heutzutage mit dem Begriff der Inklusion vieles gemeinsam. »Von vornherein (sollte) verhindert werden, dass Integration notwendig wird, denn der Begriff setzt ja eine vorangegangene Isolation voraus« (Schöler, 1983, in Schildmann, 1996, S. 22).
Nach Speck (1999) hat der Begriff der Integration zwei Seiten: sowohl benötigte Kompetenzen des Individuums als auch Motivation bzw. positives Bemühen der Gesellschaft. Diese Auffassung schließt sich an das Normalisierungskonzept von Nirje an (siehe oben), wobei dieser Integration als »die Beziehung zwischen Menschen auf der gegenseitigen Anerkennung der Integrität des anderen und auf gemeinsamen Grundwerten und Rechten« versteht (Nirje, 1994, S. 200). Die Gleichstellung aller Menschen mit oder ohne Behinderung, und die gleichberechtigte Teilnahme am gesellschaftlichen Leben ist dabei unbedingte Voraussetzung für ein funktionierendes, gleichberechtigtes Leben in der Gesellschaft (vgl. Stöppler, 2002, S. 29).
Seifert (1997) bezieht die Integrationsebenen auf den Wohnalltag von Menschen mit geistiger Behinderung. Sie unterscheidet:
»Räumliche Integration: Wohneinrichtungen sind in normalen Wohngegenden angesiedelt.
• Funktionale Integration: Allgemeine Dienstleistungen werden auch von Menschen mit geistiger Behinderung in Anspruch genommen (z. B. öffentliche Verkehrsmittel, Restaurants, Schwimmbäder).
• Soziale Integration: Die sozialen Beziehungen in der Nachbarschaft sind durch gegenseitige Achtung und Respekt gekennzeichnet.
• Personale Integration: Das Privatleben wird durch das jeweilige Lebensalter entsprechende persönliche Beziehungen zu nahestehenden Menschen als emotional befriedigend erlebt. Im Erwachsenenalter beinhaltet dies ein möglichst selbstbestimmtes Leben außerhalb des Elternhauses.
• Gesellschaftliche Integration: Menschen mit geistiger Behinderung werden in Bezug auf gesetzliche Ansprüche als Mitbürger akzeptiert. Sie können bei Entscheidungen, die ihr Leben und ihren Alltag betreffen, mitbestimmen – sowohl als Einzelperson als auch als Mitglied von Selbsthilfegruppen.
• Organisatorische Integration: Die organisatorischen Strukturen einer Gemeinde fördern und unterstützen die Integration von Menschen mit geistiger Behinderung« (ebd., S. 27).
Wirkliche Integration ist nur möglich, wenn Individuen einerseits die Normen, Werte und Regeln einer Gesellschaft internalisieren können und in partizipatorisches Handeln umsetzen können, die Gesellschaft aber andererseits alles dafür tut, eine gleichberechtigte Teilnahme zu ermöglichen. Für eine gelungene Sozialisation und das Ermöglichen einer Teilnahme braucht auch der Mensch mit geistiger Behinderung Anleitung und Unterstützung, um:
• »Kommunikationsfertigkeiten und -möglichkeiten zu entwickeln und zu erschließen,
• soziale Verhaltensweisen auszubilden und soziale Interaktionen zu unterstützen und zu erweitern,
• die Übernahme, das Erlernen sozialer Rollen zu ermöglichen,
• die Teilhabe an Gruppenerfahrungen und -aktivitäten auszubauen und das Zugehörigkeitsgefühl zu verstärken,
• die konkrete Eingliederung in Spielgruppen, Lerngruppen, Arbeitsgruppen und Freizeitgruppen zu begleiten und zu stabilisieren,
Читать дальше