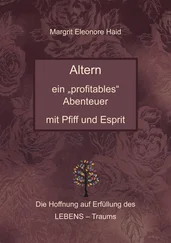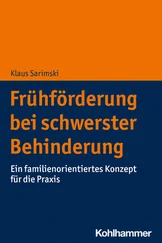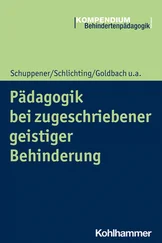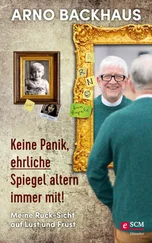3 Theoretische Konzepte für die Altersphase
Im Laufe der Geschichte der Geistigbehindertenpädagogik haben sich die Leitideen, die die Erziehung und Bildung von Menschen mit geistiger Behinderung prägten, umfassend verändert (vgl. Stöppler, 2017, S. 69). Damit eingehend gab es in den letzten Jahrzehnten einschneidende Veränderungen in den Auffassungen über eine geeignete Begleitung von älteren Menschen mit geistiger Behinderung. Diese Konzepte basierten auf Normalisierung, sozialer Integration, Selbstbestimmung sowie Inklusion und Teilhabe.
Die grundlegenden Initiativen und Perspektiven sind inzwischen schon ein halbes Jahrhundert alt. Die praktische Umsetzung hat jedoch eine viel jüngere Geschichte und ist noch immer aktuell. In den verschiedensten Lebensbereichen wie Freund- und Bekanntschaften (  Kap. 9), Wohnen (
Kap. 9), Wohnen (  Kap. 8), Arbeit (
Kap. 8), Arbeit ( 
Kap. 7
), Freizeit und Erwachsenenbildung (  Kap. 10und
Kap. 10und  Kap. 14) ist der Prozess des Umdenkens und Umsetzens dieser Prinzipien in die direkte Begleitung noch nicht abgeschlossen. Vieles ist wohlformuliert in Grundsatzerklärungen und Broschüren der Anbieter niedergeschrieben, jedoch noch immer oft gering und fragmentarisch in der Praxis realisiert.
Kap. 14) ist der Prozess des Umdenkens und Umsetzens dieser Prinzipien in die direkte Begleitung noch nicht abgeschlossen. Vieles ist wohlformuliert in Grundsatzerklärungen und Broschüren der Anbieter niedergeschrieben, jedoch noch immer oft gering und fragmentarisch in der Praxis realisiert.
Die Auseinandersetzung mit den im Folgenden skizzierten Grundideen zur Begleitung haben jedoch wesentlich zum Umdenken über die Gestaltung von Dienstleistungen für ältere Menschen mit geistiger Behinderung beigetragen.
3.1 Deinstitutionalisierung/Enthospitalisierung
Die meisten soziologischen Theorien der Begleitung von Menschen mit geistiger Behinderung haben direkte oder indirekte Wurzeln in der Institutionenkritik auf Großeinrichtungen der Psychiatrie und der Behindertenhilfe. Mit der Kritik an die Psychiatrie fing es an. Im westeuropäischen Modell (z. B. Deutschland, Niederlande, Dänemark) lag (und liegt teilweise immer noch) ein starker Fokus auf institutionelle Behandlung, Versorgung und Begleitung. In den 1950er bis 1970er Jahren kommt erste Kritik an den Institutionen auf (z. B. Goffman, 1961; Basaglia 1973). Es gab zunehmend schockierende Erfahrungsberichte von Familienmitgliedern oder Personal in den Medien oder in der Literatur. Es wird über die »Totale Institution« (Goffman, 1961) mit allumfassender Einschränkung der Bewegungsfreiheit der Insassen, völlige Überwachung und über behinderte Entwicklung und deutliche Verstöße gegen Menschenrechte berichtet. Mittels folgender vier Merkmale charakterisiert Goffman die von ihm als »total« bezeichneten Institutionen: (1) die Schranken zwischen den Lebensbereichen sind aufgehoben, (2) alle Angelegenheiten des Lebens finden an einem Ort unter einer Autorität statt, (3) alle Phasen des Alltags werden gemeinsam mit »Schicksalsgenossen« auf die gleiche Art und Weise verbracht, (4) alle Phasen des Arbeitstages sind exakt geplant − die erzwungenen Tätigkeiten unterliegen einer rationalen Planung, die angeblich am Ziel der Institution ausgerichtet ist (vgl. ebd., S. 17).
Eine häufig genannte Auswirkung der kritisierten Institutionen ist der soziale Ausschluss – die Ausgrenzung für Menschen, die in einer totalen Institution leben. Bei Basaglia ist der soziale Ausschluss einerseits Definitionskriterium für die »Institutionen der Gewalt« wie auch Begründung für die Forderung nach Veränderungen (Falk, 2016, S.21). Basaglia analysiert, dass der soziale Ausschluss durch totale Institutionen eine gesellschaftliche Funktion hat. »Genauso ist die Existenz der Irrenanstalten […] nur Ausdruck für das Bestreben, alles einzuschließen, vor dem man sich fürchtet, weil es unbekannt und unzugänglich ist. Dieses Bestreben wird von einer Psychiatrie legitimiert und wissenschaftlich untermauert, die das Objekt ihrer Studien für unverständlich hielt und es infolgedessen in die Kolonie der Ausgeschlossenen abschob…« (Basaglia, 1973, S.146, zit. n. Falk, 2016, S. 22).
Der Begriff »Deinstitutionalisierung« umfasst zwei Bedeutungen, die miteinander zusammenhängen. Deinstitutionalisierung ist einerseits ein Ideal über die gewünschte Position des behinderten Menschen in unserer Gesellschaft, beschrieben mit den Konzepten Normalisierung, soziale Inklusion und Teilhabe von Menschen (Bouras & Ikkos, 2013; Chow & Priebe, 2013; Kunitoh, 2013; Nicaise, Dubois & Lorant, 2014). Der Begriff der Deinstitutionalisierung bezieht sich jedoch auch auf den gesamten Kapazitätsabbau großer Einrichtungen/Krankenhäuser und/oder deren Aufteilung/Dezentralisierung in kleine Begleitungseinheiten, die autonomer funktionieren.
Deinstitutionalisierung als der geplante Abbau der Großeinrichtungen wird danach in mehreren Ländern – oft nur teilweise – umgesetzt. Ab den 1950er Jahren fand diese Entwicklung in Skandinavien, den USA, Großbritannien und Italien und später in vielen anderen Ländern von Kontinentaleuropa statt. Die Großeinrichtungen standen unter medizinischer Leitung, vielfach eines Psychiaters, da die Ursache der geistigen Behinderung primär als eine Gehirnerkankung gesehen wurde. Alle körperlichen und geistigen Gesundheitsbedürfnisse sollten in diesen Einrichtungen abgedeckt werden. Menschen mit geistiger Behinderung kamen selten mit allgemeinen Dienstleistungen in Kontakt. Während der Deinstitutionalisierungsbewegung wurden viele dieser Langzeitkrankenhäuser geschlossen. In Großbritannien sank die Anzahl von Betten von 64.000 im Jahr 1970 auf 3.950 in 2013 (Royal College of Psychiatrists, 2013). Auch die Rolle der in diesem Bereich tätigen Psychiater änderte sich. Von Ärzten für geistige Behinderungen, die sich mit allen Aspekten der körperlichen und geistigen Gesundheitsversorgung von Menschen befassten, wurden sie zu Spezialisten, die in erster Linie für die Bewältigung psychischer Gesundheits- und Verhaltensprobleme verantwortlich sind.
Brennenwold et al. (2018, S. 2) nennen drei Ursachen für den Auszug von Patienten aus den großen psychiatrischen Einrichtungen.
Die erste Ursache war die Entwicklung wirksamer Psychopharmaka in den 1950er Jahren (Becker & Kilian, 2006, S. 9). Diese ermöglichte es den Patienten mit einer psychiatrischen Behinderung, ein relativ normales Leben in der Gemeinschaft zu führen, unterstützt von ambulanten Pflegeeinrichtungen.
Die zweite Ursache war die Entstehung eines Bürgerrechtsparadigmas für Menschen mit einer Behinderung, nämlich, dass sie als Patient und Bürger in einer Umgebung behandelt werden sollten, die ihre Bürgerrechte am geringsten einschränkt. Dieses Prinzip der Normalisierung wurde erst nach vielen Jahren, nämlich 2006 in der Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen bekräftigt. Leben in einer großen Einrichtung gilt in der Regel nicht als »wenig restriktive Umgebung«, da dies die Selbstbestimmung begrenzt und die Abhängigkeit erhöht (Novella, 2010, S. 223; Trappenburg, 2013, S. 3). Weiter bilden Abhängigkeit und das Führen eines abgeschotteten Lebens außerhalb der sozialen Gemeinschaft Risikofaktoren für (sexuellen) Missbrauch (Crossmaker, 1991). Dagegen wird das Leben in der Gemeinschaft als Mittel zur Genesung und Rehabilitation sowie zur sozialen Eingliederung von Patienten angesehen (Bouras & Ikkos, 2013; Novella, 2010).
Читать дальше
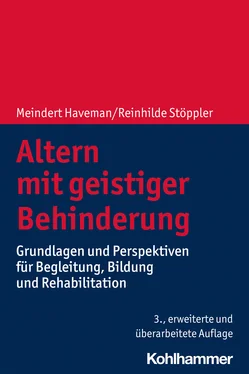
 Kap. 9), Wohnen (
Kap. 9), Wohnen (