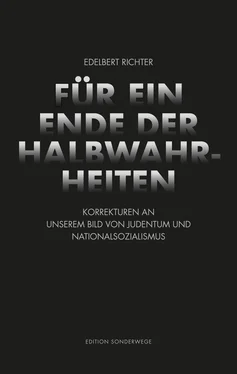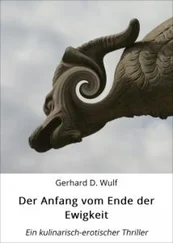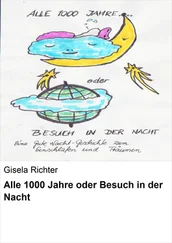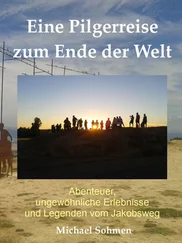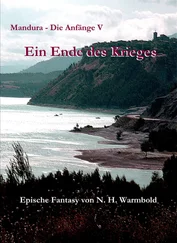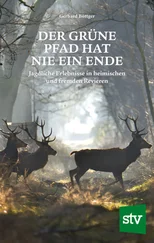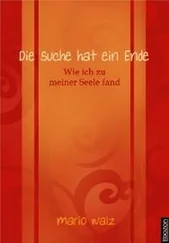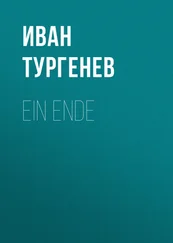Es ist gar keine Frage – was Jahwe hier als »Bann« (Aussonderung) gebietet, würde man heute als Völkermord bezeichnen. Freilich dürfen wir unsere Begriffe und Vorstellungen, etwa des Völkerrechts, nicht auf diese weit zurückliegende Vergangenheit übertragen, stattdessen müssen wir zunächst verstehen, wie damals gedacht wurde. Die Massaker wurden nämlich als kultische Opferhandlungen aufgefasst. Dem Gott, der den Sieg gebracht hatte, wurden die Besiegten samt Frauen, Kindern und Besitz dankbar geopfert und damit übereignet. Dies geschah offenbar, um den Gott günstig zu stimmen, damit er weitere Siege ermöglichte. Denn von ihm war nach damaliger Auffassung letztlich der Kriegsverlauf abhängig. Eigentlich war er es, der primär kämpfte, während das Volk nur sein Werkzeug und dessen Kampf nur sekundär war. Dies erklärt auch das aus ökonomischer Sicht Sinnlose dieses Abschlachtens, der Verzicht auf Beute und auf Versklavung der Unterworfenen, was mit einiger moralischer Anstrengung als die positive Seite der Sache betrachtet werden kann. Sinnlos erscheint uns aber ebenso, dass Leben – wie auch bei anderen Opfergaben – vernichtet werden musste, wenn es dem Gott übereignet werden sollte. Ist denn nicht ohnehin alles Gottes Eigentum? Bedarf Gott der Tötung von Mensch und Tier und hat sogar Freude daran, während er andererseits doch den Schutz alles Lebendigen fordert?!
Aber dieser Widerspruch erklärt sich daraus, dass wir es eben mit dem einen Gott eines Volkes zu tun haben, nicht mit dem Gott der gesamten Menschheit. Sein Schutz gilt nur dem Volk seines Eigentums, fremde Völker können, eben weil sie fremd sind, nur durch Auslöschung sein Eigentum werden.
Es gibt nun verschiedene Möglichkeiten, mit diesen mehr als anstößigen biblischen Aussagen zurechtzukommen. Eine Möglichkeit, an ihnen vorbei- oder um sie herumzukommen, besteht allerdings nicht. Denn sie finden sich gerade im Deuteronomium, der unbestrittenen Mitte des Alten Testaments, und darüber hinaus recht zahlreich in anderen Büchern (Numeri, Josua, Samuel), insgesamt an rund 70 Stellen. 31
Ein verbreitetes und notwendiges hermeneutisches Verfahren besteht darin, inhaltlich zwischen Zentrum und Peripherie der biblischen Botschaft zu unterscheiden und jene Aussagen dann der Peripherie zuzuweisen. Notwendig ist dieses Verfahren, weil gerade die Texte über die Landnahme der Israeliten in der neuzeitlichen Geschichte eine unheilvolle Wirkung entfaltet haben, 32indem man gerade sie als zentral ansah oder indem man es in fundamentalistischer Weise überhaupt ablehnte, zwischen Zentrum und Peripherie zu unterscheiden und alle Aussagen der Bibel als gleichwertige Offenbarung nahm.
Dennoch halte ich jenes Verfahren in diesem Fall für fragwürdig, und zwar aus einem einfachen logischen Grund: Kann denn etwas Peripheres im strikten Widerspruch zu seinem Zentrum stehen? Offensichtlich nicht, denn das Periphere ist zwar das weniger Wichtige, aber doch positiv aufs Zentrum bezogen. Ähnlich verhält es sich, wenn man davon ausgeht, dass es eine geschichtliche Entwicklung im Gottes- wie auch im Rechtsverständnis gegeben hat. Dann zählt man die anstößigen Aussagen zur Vorgeschichte und lässt die eigentliche, uns betreffende Geschichte etwa erst mit den großen Propheten beginnen. Nur gerät man dabei in die Schwierigkeit, doch eine Kontinuität zwischen beiden annehmen zu müssen. Was hat aber der Gott, der von uns Feindesliebe verlangt, noch mit jenem Volks- und Kriegsgott gemein?
Eine weitere Möglichkeit, mit den unsäglichen Texten umzugehen, besteht darin, dass man nach gründlicher Forschung zu dem Schluss kommt, dass nichts so heiß gegessen wird, wie es gekocht wurde. Erstens geben antike Berichte die historische Realität meist ohnehin nicht getreu wieder, sondern übertreiben gewaltig. Zweitens kann man sich die Landnahme der Israeliten schon aufgrund der Kräfteverhältnisse zwischen ihnen und den entwickelten kanaanäischen Städten nur als einen allmählichen und im Wesentlichen doch friedlichen Prozess vorstellen. 33
Gegen diese These spricht freilich, dass am Ende des angeblich friedlichen Prozesses doch das Davidische Großreich stand. Es gibt aber wohl kein Beispiel in der Geschichte, wo ein ähnliches Reich ohne massive Gewalt zustande gekommen wäre. Andrerseits kennen wir viele Beispiele dafür, dass »barbarische« Völker in eine entwickelte, aber kriegsmüde gewordene Zivilisation eingefallen sind, sie trotz ihrer geringeren technischen Rüstung aufgrund ihrer größeren Opferbereitschaft bezwungen und dann überschichtet haben. So ist denn auch die Theorie, dass es sich sehr wohl um eine Eroberung gehandelt habe (allerdings durch verschiedene Nomadenstämme und in einem längeren Zeitraum), lange vertreten worden, besonders eindrücklich durch den amerikanischen Archäologen William F. Albright. Sie hat gerade in Israel nach der Staatsgründung viel Beifall gefunden und eine intensive, staatlich geförderte archäologische Forschung ausgelöst. Der ruhmreiche Generalstabschef Moshe Dajan war selbst ein eifriger Sammler von Fundstücken. In seinem Buch Mit der Bibel leben (1978) erscheint die historische Zeit wie ausgelöscht: Die Eroberung Kanaans verschmilzt geradezu mit den Kriegen von 1948 und 1967. 34Allerdings waren die Ergebnisse der Forschung nicht immer überzeugend und schließlich sogar so widersprüchlich, dass inzwischen die Meinung vorherrscht, von einer solchen Landnahme, wie sie etwa im Josuabuch geschildert wird, könne doch keine Rede sein. So ergaben die Ausgrabungen, dass die Städte Jericho und Ai zur Zeit der angeblichen Eroberung um 1200 v. Chr. schon gar nicht mehr bestanden. Es handelt sich vielmehr um eine Geschichtskonstruktion aus sehr viel späterer Zeit. Sie will sagen, wie die Kriege »eigentlich hätten geführt werden sollen«, aber nicht, wie sie wirklich verlaufen waren. 35Da die erzählten Kriegshandlungen meist mit dem Bann enden, hätten die israelitischen Stämme das Land ja in eine tabula rasa verwandeln und kulturell völlig neu beginnen müssen. 36Wir kennen diese Art der Abrechnung mit der Geschichte und der Utopie eines radikalen Neuanfangs.
Was bedeutet das für unsere Fragestellung? Auch wenn die Texte nicht die Realität widerspiegeln, sondern das Bannen nur fordern, so bedeutet das im Grunde keine Entlastung, weil sie eine Denkweise der Verfasser offenbaren, die uns fremd und ungeheuerlich anmutet. Wobei wir nicht übersehen wollen, dass uns ein ähnlich ideologisches Denken aus unserer Zeit durchaus bekannt ist.
Eine etwas andere Deutung ergibt sich, wenn wir davon ausgehen, dass das deuteronomistische Geschichtswerk im Kern wahrscheinlich zur Zeit des Königs Josia (639–609 v. Chr.) entstanden ist, der eine Restauration des Davidischen Reichs anstrebte. 37War es da nicht naheliegend, zur Legitimation eine heroische Vergangenheit zu konstruieren? Auch das kennen wir sehr gut aus der modernen nationalen Geschichtsschreibung. 38
Wenn wir demnach insofern einen gewissen Realitätsgehalt der Aussagen über das Bannen annehmen müssen, als jedenfalls der Wille dazu vorhanden war, so bleibt als letzte Möglichkeit die der Relativierung. Andere Völker haben es genauso gemacht, sind nicht weniger grausam gewesen. Das ist sicher richtig. Darüber hinaus muss man natürlich beachten, dass Israel ein kleines, von den mächtigen Reichen in seiner Nachbarschaft bedrängtes Volk war. Musste es nicht, wenn es überhaupt bestehen wollte, deren Methoden übernehmen? Nur stellt sich dann wieder die Frage, wodurch sich Israel dann vor ihnen auszeichnet, worin seine Erwählung besteht. Besteht sie etwa darin, dass es für seine grausamen Vorhaben im Unterschied zu den anderen eine gute Legitimation hatte? Oder darin, dass es sich überhaupt die Mühe gemacht hat, über sie zu reflektieren und Rechenschaft abzulegen, während die anderen blind und naiv handelten? Zwar wird an einigen Stellen des Alten Testaments auch den Assyrern die Vollstreckung des Banns zugeschrieben, 39ansonsten haben wir jedoch nur einen außerbiblischen Text aus jener Zeit, der die Vernichtung einer Stadt in analoger Weise als Opferhandlung deutete. Es ist die immer wieder zitierte Inschrift des moabitischen Königs Mesa aus dem 9. Jahrhundert v. Chr. 40In Bezug auf die ideelle Rechtfertigung der Grausamkeiten steht der Versuch der Relativierung somit auf schwachen Füßen.
Читать дальше