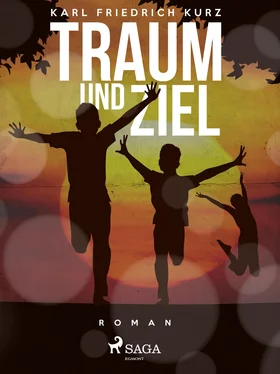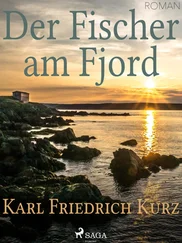Nichts.
Möglicherweise geschah es ohne Absicht, ohne Überlegung; aber der Leibriemen sauste von hoch oben herab, mit der blanken Schnalle voran. Die Eisenschnalle traf Konrad an die Schläfe mit merkwürdig hartem Aufschlag. Rotes Blut floss über die eingesunkene Wange. Auch jetzt noch kein Laut. Das wurde unheimlich; Hannes Frank selber, der einzige und allmächtige Mann in dieser Stube, schien sich zu fürchten vor dem stummen Knaben. Wahrscheinlich brüllte er deshalb so gewaltig. Und es kam ihm wohl nur gelegen, dass die Frauen endlich von allen Seiten herbeisprangen, ihn umringten und seine Arme niederdrückten.
Im allgemeinen Tumult entkamen die Knaben.
Arnold und Emil verkrochen sich in ihren Betten, im grossen, prächtigen Saal, bei den lächelnden Göttinnen. Werner lief zum Haus hinaus.
Der Mond war aufgegangen. Riesengross schwebte er über dem Dächergewirr der Stadt. Werner lief durch den Garten und suchte den Schatten der Bäume. Wo war sie nun, die helle Freude des Morgens? Wo war es, das Glück des Mittags?
Auf der hohen Mauer, die steil zum Wasser niederfiel, sass Konrad und schaute hinaus in die unbegreifliche Welt mit ihren Wundern und Schrecken. Völlig unbeweglich sass er; ein Stein auf den vielen Steinen der alten Mauer. Er drehte nicht einmal den Kopf, als er leise Schritte hinter sich vernahm, als eine bebende, eine zagende Hand sich unter seinen Arm schob. Jetzt waren es zwei Steine, die die vermooste Mauer um ein geringes überragten, zwei kleine, verschüchterte Menschenwesen, unendlich verlassen in der stillen Nacht.
Tief unten plätscherte der Rhein; es gemahnte an weinerliches, schläfriges Kindergemurmel. Als ein paar gezackte Kreidestriche hoben sich die langen Häuserreihen am anderen Ufer aus dem blaudunklen Himmel. Mondlicht flackerte in unruhigen Bändern und Ringen am Fuss der Böschung, legte sich silbern um schwarze Steine. Stille war und tiefer Friede überall.
Eine verhaltene Stimme fragte: „Aber du hast doch etwas weggetragen — nicht?“
„Ja.“
„Was war es denn?“
„Frage nicht. Ich kann es nicht verraten.“
„Nein, nein.“
Schweigen und sanftes Wellengemurmel. Das Mondlicht fällt auf Konrads Gesicht und zeichnet deutlich die dunkle Blutlinie, die von der Schläfe über die Wange hinläuft bis hinunter zum Hals.
„Ich werde Wasser holen und ein Tuch. Ich will es abwaschen.“
„Lass es nur“, sagt Konrad fast feierlich. „Das tut gar nicht weh. Und wenn er mich umgebracht hätte, würde ich nichts verraten haben.“
In stummer Bewunderung schaut Werner auf zu dem Pflegebruder, der ein Geheimnis hat; ein Geheimnis, für das er leiden und sterben will. Das Dasein wird auf einmal gross und voll dunkler Tiefe. „Arnold meinte es nicht böse, verstehst du. Er verplapperte sich nur aus Angst, denn er ist noch so klein und dumm ...“
„Ach Arnold“, seufzt der merkwürdige Konrad und lächelt dabei.
„Warum muss er immer so roh und gemein schlagen? Uns zu schlagen ist keine Heldentat; er weiss ja, dass wir uns nicht wehren können.“
„Dein Vater? Er versteht das wohl nicht besser. Sicher hat er selber als Knabe viel Prügel bekommen. Nun meint er, die Reihe sei an ihm, zu schlagen. Die Grossen schlagen die Kleinen. So muss es stets sein. Was meinst du?“
„Ich weiss nicht ...“
Es reden nun diese beiden verprügelten Knaben und unterhalten sich über die mangelhafte Einrichtung dieser Welt. Altklug sind sie beide, durch Not und Bitternis frühreif geworden. Sie haben einen scharfen Blick für das Wesen der Menschen und der Dinge.
„Und das, was er über die Wandgemälde sagte, ist nichts als Unsinn“, meint Konrad. „Es sind Darstellungen aus der Götterlehre der alten Römer. Eins davon ist bestimmt die Jagd der Diana.“
„Ist das sicher?“
„Ja. Ich habe ein ähnliches Bild im Museum gesehen. Wenn du willst, können wir am nächsten Sonntag hingehen; da ist es für jedermann geöffnet und kostet keinen Eintritt.“
So schnell wird das Übel überwunden und vergessen. Diese zerbrechlichen Menschenfigürchen haben Stahlfedern im Leib. Sie werden zu Boden geworfen und flachgedrückt; aber kaum lässt der Druck nach, fahren sie leicht wieder in die Höhe.
„Im Museum — sind dort richtige Bilder?“
„Ja. Gemälde berühmter Künstler.“
„Von Raffael?“
„Ach, das war ja nur einer von vielen, und er ist längst tot. Natürlich konnte er allein nicht tausend Zimmer ausmalen. Dein Vater weiss wenig; aber er schwatzt viel.“
„Glaubst du, dass ich ein berühmter Maler werden kann?“
„Freilich — warum nicht ...“
„Ich glaube es.“
Aber hierauf sagt Konrad etwas, was ganz und gar nicht zu dieser Sache gehört; er blickt den Mond an und sagt: „Ich wundere mich, in welchem Zimmer sie schlief ...“
„Wer?“
„Die Waise.“
„Sie schlief gewiss bei ihren Eltern.“
„Nein, sie hatte ein Zimmer für sich allein. Sie waren doch sehr vornehme Leute, musst du begreifen ...“
„Warum willst du wissen, wo sie schlief?“
„So ... Sie ist immer allein und still und traurig. Nie kommt sie auf die Strasse hinaus zu uns anderen. Nur hinter dem Eisengitter steht sie. Aber sie lacht und kreischt nicht wie andere Mädchen. Ich habe Purzelbäume vor ihrem Tor geschlagen ...“
„Sie ist ein schönes Mädchen“, meint Werner bedächtig.
„Ich kann dir nur versichern, dass sie das schönste Mädchen der Stadt ist. Ja, vielleicht gibt es nicht ihresgleichen in der ganzen Welt. Sie steht himmelhoch über uns ...“
Damit endete das nächtliche Gespräch auf der hohen Mauer über dem Rhein. Die beiden Knaben sassen noch lange schweigend nebeneinander, jeder mit seinen eigenen Gedanken.
Der Mond streute grüngoldenes Licht auf die Erde. Der mächtige Strom rauschte mit seinen Wellen.
Es gab einen Mann, der heimlich durch das weitläufige Haus und durch die tiefen Keller schlich, und das war ein Mann, der allen Ernstes das Glück suchte, den verborgenen Schatz. Seht, der alte Klaus Lohmann wollte diesmal nicht abseits stehen, wenn die Unsichtbaren ihre Gaben ausstreuten. Deshalb ergriff er Emils Hammer und begann eine Tätigkeit. Er suchte, während die anderen schliefen.
Nun war leider der Schlaf der Frauen nicht tief genug, und sie vernahmen ein dumpfes Klopfen. Es war Elisa, die rief: „Allmächtiger Vater — hört ihr nichts?“
„Was denn?“ fragte es aus dem Dunkeln.
„Macht Licht! O Herr des Himmels — es klopft ...“
Das Gaslicht wurde angezündet. Die Frauen wussten es nicht, aber es war dasselbe Gaslicht, das dem Ehepaar Bondorf den Tod brachte. Aufgeschreckt sassen sie in ihren Betten und lauschten. Es klopfte. Drei dumpfe Schläge, bald da, bald dort. Es klopfte. „Bete, Mutter!“ flüsterten sie.
Die Grossmutter holte die grosse Bibel, setzte ihre Brille auf und las mit singender, vor Angst flatternder Stimme den prachtvollen Psalm, den sie zu lesen pflegte, wenn ein schweres Gewitter am Himmel tobte. „Wer unter dem Schutze des Höchsten steht und im Schatten des Allmächtigen wandelt ...“, las sie.
Es klopfte weiter.
Siebenmal las die Grossmutter den Psalm. Aber das Gespensterklopfen horte nicht auf. „Sie haben sich selber ums Leben gebracht, nun dürfen sie im Grab keine Ruhe finden“, sagte darauf die Grossmutter.
In Elisa steigt jäh ein kühner Gedanke auf. „Vielleicht gilt das uns“, flüstert sie heiss. „Ja, vielleicht sind wir auserkoren, diese armen Seelen zu erlösen.“
Ein glorreicher Gedanke! Ein Unternehmen, ganz nach dem Herzen der Lohmanns. „Wir wollen um ihre armen Seelen ringen“, sagen die Frauen zueinander. „Wir wollen ihnen die ewige Ruhe verschaffen.“
Abwechselnd beteten sie und flehten den Herrn um Erbarmen. „Vergib ihnen, o Herr!“ riefen sie inbrünstig.
Читать дальше