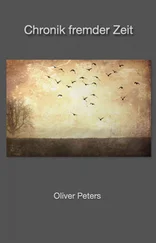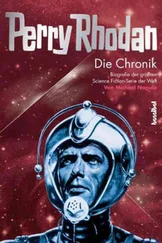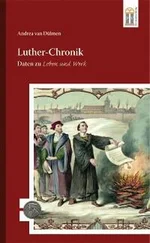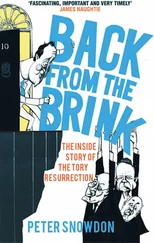Etwa ein Jahr später wird er erneut auf einen Botengang zu der Schwester auf der Nachbarsfarm geschickt. Diesmal wegen eines Todesfalls in der Familie (eines der Kinder ist von einer Giftschlange gebissen worden); in dem Korb sind zwanzig Quitten. Und ein zusammengefalteter Brief.
Unterwegs überkommen ihn Müdigkeit und Hunger. Der Geschmack einer Quitte ist nichts im Vergleich zur Süße eines Granatapfels. Aber er kann der Versuchung nicht widerstehen. Er weiß, er findet keine Ruhe, wenn er nicht vorher eine Quitte kostet. Diesmal wird er sich aber nicht ertappen lassen wie beim letzten Mal. Er nimmt also zuerst den Brief, den die Nooi mitgeschickt hat, und versteckt ihn unter einem flachen Stein hinter einem großen Felsbrocken. Und erst, als er die Quitte aufgegessen und sorgsam alle Spuren seines Festmahls beseitigt hat, holt er den zusammengefalteten Brief unter dem flachen Stein hervor und macht sich wieder auf den Weg.
Aber dann kommen sie ihm, so sicher, wie es Heitsi-Eibib gibt, auch diesmal auf die Schliche und fragen nach der fehlenden Quitte.
Mit Tränen in den Augen erklärt er der Frau, was alles für Vorkehrungen er mit dem Verstecken des Briefes getroffen hat. Bestimmt hat Gaunab, so erklärt er, den Brief mit einem Fluch belegt, um ihn zu verderben. Zu seinem Erstaunen bricht die weiße Frau in Lachen aus, bis auch ihr Tränen über die Wangen rinnen.
»Jetzt hör mal gut zu, Kupido«, setzt sie an, und er merkt an ihrer Stimme, dass er diesmal nicht ausgepeitscht werden wird. »Nicht der Brief hat dich ausspioniert. Aber beim letzten Mal hat deine Madam geschrieben, dass sie dich mit zwölf Granatäpfeln, und heute, dass sie dich mit zwanzig Quitten losgeschickt hat.«
»Aber der Brief ist doch stumm«, wendet er ein. »Er hat keinen Mund, er kann nicht sprechen.«
»Nein, Mund hat er keinen. Aber ich werde dir zeigen, auf welche Weise er spricht. Hör gut zu.« Und langsam und deutlich, Wort für Wort liest sie ihm vor, was der Brief sagt.
Kupido versteht das immer noch nicht so recht. Er weiß nur, das ist etwas, das größer ist als er. Auf irgendwie geheimnisvolle Weise hat der Brief etwas mit dem großen braunen Buch zu tun, das der Baas bei der Abendandacht zur Hand nimmt, wenn er betet und sich in langen Reden über Gott und Baas Jesus und jede Menge anderer Leute, von denen keiner je gehört hat, ergeht.
Diesmal spricht er mit seiner Mutter über die Angelegenheit.
»Ich möchte auch Worte auf Papier setzen, Ma«, sagt er. »Das ist ein starker Zauber. Was sie Schreiben nennen, hat Leben in sich und kann weiter und schneller rennen, als du je gelaufen bist.«
»Das wäre dein Tod, Kupido«, warnt sie ihn, so wie immer.
Doch bei der erstbesten Gelegenheit, die sich bietet, spricht er furchtlos die Frau des Baas an. Sie findet das so komisch, dass sie, wie ihre Schwester auf der Nachbarsfarm, zu lachen anfängt. Doch er bleibt geduldig vor ihr stehen, bis sie ausgelacht hat, und sagt dann: »Wird die Madam mir also das Schreiben beibringen?«
»Nein«, sagt sie.
Er spürt, wie alles Leben aus ihm sickert, so wie Spucke im Sand versickert. »Madam!«
Sie erklärt, für derlei Torheiten habe sie keine Zeit. Sie werde aber ihre großen Töchter Cornelia und Jacoba fragen. Vielleicht könnten die es mal versuchen.
6. Begegnung mit einem Löwen
Aber das hält nicht lange vor. Für die beiden Mädchen – Cornelia ist fünfzehn, Jacoba dreizehn – ist es ein Riesenspaß, ihm etwas beizubringen. Für sie ist er wohl so etwas wie der kleine Affe, den sie großgezogen haben, nachdem die Hunde im Busch seine Mutter getötet hatten. Ganze Tage verbrachten sie damit, ihm Tricks und Kunststücke beizubringen, bis er einfach zu aufdringlich und ungebärdig wurde, so dass die Jungen ihn totschlagen mussten. Kupido begreift erstaunlich schnell, was auch immer sie ihm beibringen, und wird seines Eifers wegen allmählich sogar irgendwie lästig. Und er fängt an, seine Pflichten auf der Farm zu vernachlässigen. Also setzt der Baas dem Ganzen bald ein Ende.
»Was will ein Hottentotte denn mit Lesen und Schreiben anfangen?«, fragt er. »Damit schafft er sich nur Probleme. Eines Tages glaubt er dann gar, er sei ein Weißer, und dann weiß er nicht mehr, wo sein Platz ist. Er soll seine Arbeit machen. Und wenn er so viel Zeit übrig hat, dass er sie für Lesen und Schreiben vergeuden kann – nun, ich weiß genug anderes, um ihn zu beschäftigen. Damit muss Schluss sein, auf der Stelle. Und wenn ihr Mädchen nicht hören wollt, bekommt ihr genauso eine Tracht Prügel wie er. Verstanden?«
Damit haben die Unterrichtsstunden ein Ende, nicht aber die schier unerträgliche Sehnsucht, die in seiner Brust brennt wie ein Stück glühender Kohle, die da drinnen glimmt und nicht herauskann. Er versucht noch, allein weiterzumachen, aber das ist nicht einfach, und niemand hilft ihm, wenn er nicht mehr weiterweiß. Er hat keine Schiefertafel und keinen Griffel, ganz zu schweigen von Federhalter und Papier, und es ist gar nicht so einfach, die Worte auf den Sandfleck, den er im Hinterhof glattgestrichen hat, zu kratzen. Nein, er gibt nicht auf. Aber das Brennen wird immer schlimmer.
Außerdem bringt ihn das in Schwierigkeiten, vor allem wenn er eigentlich weit draußen im Grasland die Schafe und Ziegen hüten soll. Es ist eine günstige Gelegenheit, um zu schreiben. Doch wenn es am Spätnachmittag Zeit ist, nach Hause zu gehen, und es fehlt ein Schaf, dann ist der Teufel los.
Doch selbst das hält ihn nicht davon ab. Auf der Fährte der Geschichten seiner Mutter durchstreift er weiterhin die unfruchtbaren Himmelsstriche der Farm und kümmert sich um seine Schafe und Ziegen. Und dann passiert etwas, das die Gleichförmigkeit der Tage aufbricht. Eines Nachmittags kniet er wie üblich auf einem Sandfleck und versucht, Buchstaben zu formen, als jemand sich neben ihn setzt. Wahrscheinlich ist die grimmige Hitze schuld daran, dass er nur noch verschwommen sieht, weil Schweißtropfen ihm in die Augen kullern und er nicht so recht erkennen kann, wer oder was es ist. Zuerst sieht es aus wie ein Baum. Dann verwandelt es sich in etwas Schattenhaftes. Nach einer Weile, als er es aus den Augenwinkeln noch einmal anschaut, verändert es erneut seine Gestalt. Eine riesige Gottesanbeterin. Nein. Doch ein menschliches Wesen. Ein sehr großer, muskulöser Mann.
»Wer bist du, dass du dich so an mich ranschleichst?«, fragt Kupido zögerlich.
»Ich bin Heitsi-Eibib«, antwortet der Mann.
Kupido kriegt einen solchen Schreck, dass er beinahe hintüber fällt. Doch er ist zu benommen, um sich zu bewegen. Wie eine Maus vor einer Schlange sitzt er einfach wie gelähmt da.
»Hab keine Angst«, sagt Heitsi-Eibib. »Ich habe dir etwas mitgebracht.«
Er hält etwas zwischen Daumen und Zeigefinger und streckt es Kupido hin – den Zahn eines Löwen.
»Bind ihn dir um den Hals«, fährt er mit tiefer, leise grollender Stimme fort. »Es wird dich vor allem Übel schützen.«
Am Tag darauf und an den folgenden Tagen gewöhnt er sich allmählich an den großen Mann. Sie fangen an, sich zu unterhalten. Heitsi-Eibib kann Geschichten erzählen wie niemand sonst auf der ganzen Welt. Langsam versickert Kupidos Angst wie Wasser in trockenem Sand. Und von da an holt Heitsi-Eibib, wann immer ein Schaf oder eine Ziege streunt, sein mit Fett gefülltes Medizinhorn hervor und taucht den dünnen Dorn einer Aloe hinein, so dass nur noch eine Daumenlänge davon zu sehen ist. Den zündet er an und hält ihn in den Wind; wenn Kupido dann dem Rauch folgt, findet er mit Sicherheit das verirrte Tier. Nie wieder bekommt er vom Baas Prügel, weil er eines von den Schafen oder eine Ziege in seiner Obhut verloren hat.
Von Zeit zu Zeit, wenn er die Nacht draußen im Busch verbringen muss, bringt Heitsi-Eibib ihm bei, was er über die Sterne wissen muss. Gleich nach Sonnenuntergang, so erfährt er, muss er ganz genau hinsehen. In dem Augenblick, wenn der kleine Schwarm der Sieben Schwestern sichtbar wird, muss er so laut singen, wie er nur kann. Das bringt ihm, darauf kann er sich verlassen, Glück. Und er soll immer den Mond hoch achten, denn der ist nicht nur Heitsi-Eibib selber, sondern auch, auf irgendeine geheimnisvolle, verdrehte Art, der gute Gott Tsui-Goab, der zu Anbeginn der Zeit all die Felsen und Steine geschaffen hat, aus denen später die Menschen hervorgegangen sind. Und die Schlangen. Heitsi-Eibib zeigt ihm, dass jede kleine Quelle im Buschland von einer Schlange bewacht wird. Diese Schlange darf man nicht töten, denn dann trocknet die Quelle aus und bringt allem, was daraus sonst Leben schöpft, den Tod. Ist eine Quelle erst einmal ausgetrocknet, kann man genauso gut gleich weiterziehen. Dann ist da nur noch Stein.
Читать дальше