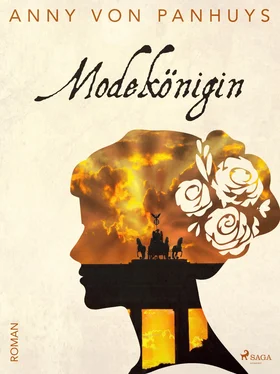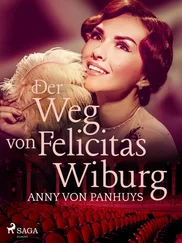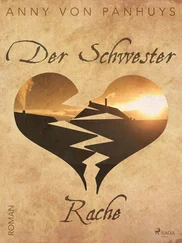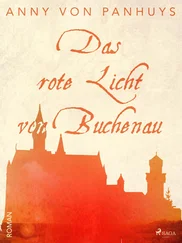Elisabeth aber war von dem Tage an, den Frau Weilert einen Glückstag nannte, in tief niedergedrückter Stimmung. Die Drohung der Fürstin von eigenen Gnaden war nicht geeignet, ihre Nerven zu beschwichtigen, die seit dem Besuch bei der Hellseherin unaufhörlich schwangen.
Frau Weilert schenkte Elisabeth ein sehr elegantes Herbstkostüm zur Belohnung, Emma erhielt einen Mantel.
Ein paar Tage nach der Verhaftung der Gauner meinte Frau Weilert, nun wäre es bald soweit, die Wahl der Modekönigin stände dicht bevor.
„Sie müssen sich von jetzt ab mehr als je pflegen, Kindchen“, riet sie, „Sie müssen mit Ihrem Körper und Gesicht umgehen wie mit einem Heiligtum. Sie sollten auch morgens und abends die stumpfsinnige Eisenbahnfahrt nicht mehr machen. Wenigstens vorläufig nicht. Ich räume Ihnen bei mir ein Zimmer ein, sprechen Sie, bitte, mit Ihrer Mutter darüber.“
Elisabeth freute sich über das Angebot.
Sie fühlte sich zu Hause nicht besonders wohl. Trotz aller Mühe, die sie sich gab, blieb ihr der Vater noch immer ein Fremder.
Die Mutter aber ging völlig in seinen Wünschen auf.
Als Elisabeth zu Hause von dem Angebot sprach, verwahrte sich Robert Tann sehr lebhaft: „Das gibt es nicht, das ist ausgeschlossen. Die Schneidermadame soll dich nicht beherbergen. Das Recht, unserem Kind ein Daheim zu bieten, lassen wir uns nicht nehmen, nicht wahr, Martheken?“
Martha Tann hatte sich durch das Glück, den geliebten Mann wiederzuhaben, beinahe zur jungen Frau zurückverwandelt. Sie kleidete sich modern und nett und das Lächeln wich jetzt nie von ihrem Gesicht.
„Bleibe bei uns, Liesel“, bat sie, „wir haben eine herrliche Wohnung in Aussicht.“
Elisabeth erklärte, ihr Aufenthalt bei Frau Weilert würde ja nur vorübergehend sein und die Hin- und Herfahrerei strenge sie ziemlich an. Da gab man nach.
Elisabeth bezog nun in der großen Wohnung der bekannten Modekünstlerin ein sehr hübsches und bequemes Zimmer. Morgens erschien bei ihr zuerst die Masseuse, ein Weilchen später der Friseur, der auch Gesichtsund Handpflege übernommen hatte.
Elisabeth wurde von Frau Weilert wie eine Kostbarkeit von unschätzbarem Wert behandelt. Sie sah in ihr schon die gekrönte Modekönigin von Berlin. Elisabeth war noch zu jung, um nicht schließlich doch etwas eitel darauf zu werden, daß solch Kultus mit ihr getrieben wurde. Sie war der Mittelpunkt des Weilertschen Modesalons, um ihre Person drehte sich jetzt hier alles.
Frau Weilert ging oft mit ihr des Abends aus. In vornehme Restaurants, ins Theater, in Kabarette. Und Elisabeth trug bei den Gelegenheiten die erlesensten Kleider und Mäntel.
Die geschäftstüchtige kluge Frau Weilert machte dadurch das junge schöne Mädchen schon zur Modekönigin, ehe noch die Wahl stattgefunden.
Ein so wundervolles und auffallendes Geschöpf wie Elisabeth Tann konnte nicht unbemerkt bleiben. Wohin sie kam, erregte sie Aufsehen.
Sie fragte sich selbst oft ganz naiv, wie war es nur möglich, daß Heino sie hatte verlassen können? Sie, die überall von neidischen Blicken der Damen und begehrlichen Blicken der Herren verfolgt wurde.
Sie wehrte sich jetzt mit aller Macht gegen ihre Liebe, die noch oft so gebieterisch und stürmisch aufbegehrte.
Sie schob auch immer wieder die Erinnerung zurück an das, was die Hellseherin gesagt hatte.
Sie wollte nicht daran denken.
Sie glaubte weder das, was die arme Kreuzlahme in dem schwarzen Spiegel gesehen haben wollte, noch das, was sie aus den Karten herausgelesen hatte.
Vielleicht stimmte es, daß sich Heino Staufen zur Zeit wirklich auf einem Schiff befand.
Dann wünschte sie von Herzen, er möchte sein Bestimmungsziel gut erreichen. Seine und ihre Wege würden doch niemals mehr zueinander führen. Sie würde ihn nie Wiedersehen, damit mußte sie sich endgültig abfinden.
Mit all ihrem Stolz mußte sie die Sehnsucht in sich bekämpfen, mit all ihrem Stolz. Denn sie war nicht so schuldig, daß er sie so hart strafen durfte, so grausam hart, mit dem Verluste seiner Liebe.
Sie lebte jetzt wie ein verwöhntes Prinzeßchen und Emma meinte neckend: „Wenn du nich Modekönigin werden solltest, bereitest du unserer Ollen die jrößte Enttäuschung ihres Lebens. Ich jlaube, dann bricht ihr das Herz vor Verzweiflung.“
Die Zeitungen interessierten sich schon für Elisabeth, Modeblätter brachten ihr Bild mit der Unterschrift: „Das schönste und graziöseste Mannequin von Berlin, vielleicht von ganz Europa!“
Filmregisseure warfen auch schon ihre Netze nach der bezaubernden Blondine aus.
Frau Weilert war äußerst zufrieden, der Boden für die „Modekönigin“ war gut vorbereitet.
Heino Staufen fuhr mit der Jacht „Lobo“ Spanien entgegen. Langsam, o, so langsam ging es. Unbegreiflich langsam.
Heino wunderte sich darüber und wagte eine Frage.
Frau Espada lächelte, wie sie stets lächelte, wenn sie mit Heino Staufen sprach.
„Wir haben doch keine Eile, gar keine Eile, und wo kann es denn schöner sein als auf dem Meer! Wir werden sogar noch tüchtig kreuzen, um den Aufenthalt unterwegs zu verlängern. Sie haben ja gleichfalls keine Eile und kommen immer noch zurecht.“
Heino stand auf dem Sonnendeck und sein Blick flog verloren weit über das Meer hin. Die blonde Frau hatte sich wieder entfernt und er befand sich nun allein. Er war es gewöhnt, allein zu sein. Ricardo Espada saß meist unten in seiner Kabine in seine Arbeiten vertieft.
Welcher Art die waren, wußte Heino nicht.
Die blonde Frau hatte ihm nur erklärt, ihr Mann arbeite am liebsten während der Seefahrt, daheim wäre er lange nicht so tätig.
Außer den Mahlzeiten sah ihn Heino Staufen wenig.
Es war ihm aber nur angenehm, er fühlte sich in der Nähe des Spaniers niemals besonders wohl und empfand heimliche Scheu vor seinem tastenden verschleierten Blick.
Heino seufzte, sein Herz tat ihm weh. Er dachte daran, daß er Elisabeths Bild zerrissen und die Fetzen ins Meer hatte hinunterfallen lassen. Aber auch ohne ihr Bild erblickte er sie immer wieder mit schmerzhafter Deutlichkeit.
Auch jetzt war die blonde Lieblichkeit wieder da, forschte mit großen Augen: Mußte es sein, das böse Auseinandergehen, ohne ein letztes gutes Wort, ohne einen letzten warmen Händedruck? Mußte es überhaupt sein, daß du so weit von mir fortgegangen bist?
Heino Staufen war es, als husche etwas an ihm vorbei.
Er blickte nach links und sah den chinesischen Steward ganz in seiner Nähe. Und nun tappte er auch schon wieder auf ihn zu, der widerwärtige Mitleidsblick, der ihn so sehr an dem kleinen mageren Männchen störte.
Er wollte seinen Platz wechseln, als es ganz leise an sein Ohr drang: „Großer Achtung vor der goldene Schnaps und die lange Tisch bei der Doktor. In das Meer ist viel Platz!“
Heino stutzte und begriff den sonderbaren Satz nicht.
„Was meinen Sie damit, Mann? Reden Sie, bitte, etwas deutlicher.“
Er sagte es ziemlich laut in befehlendem Ton.
Der Chinese tat, als verstände er keine Silbe, ja als höre er überhaupt nichts. Um seine Lippen hing das rätselhafte, geheimnisvolle Lächeln der Asiaten und mit hastigen Schritten glitt die kleine Gestalt davon.
Heino Staufen hätte meinen können, alles wäre nur Einbildung gewesen, wenn es nicht immer noch allzu deutlich in ihm nachklänge: „Großer Achtung vor der goldene Schnaps und die lange Tisch bei der Doktor. In das Meer ist viel Platz!“
Der eigentümliche Satz hatte zugleich etwas Komisches und Furchterregendes, so sinnlos er auch schien.
Was für einen Tisch hatte der Chinese gemeint und vor allem, wer war der Doktor?
Auf der Jacht befand sich doch gar kein Arzt.
In einiger Entfernung ließ sich die blonde Frau eben in einem Liegestuhl nieder. Sie blickte zu ihm herüber und er wagte sich näher, wartete darauf, daß sie ihn anredete.
Читать дальше