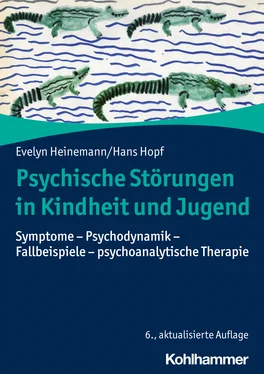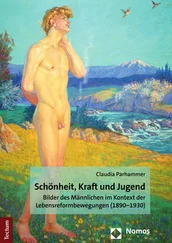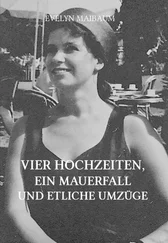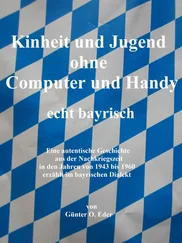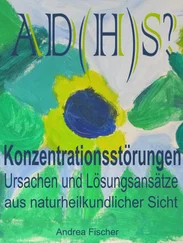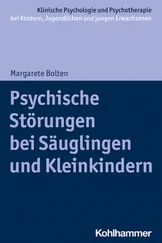Die Latenzphase ist eine Zeit der Konsolidierung zwischen dem abgeschlossenen Ödipuskomplex und der Pubertät. Sie dient der Bewältigung von Realität und dem Ich-Wachstum. Die Pubertät leitet die sogenannte Adoleszenzkrise ein, in der es im Sinne einer sekundären Individuation zur Wiederbelebung der Loslösungs- und Individuationsproblematik kommt. So wie sich das kleine Kind von der Mutter mit Hilfe des triangulierenden Vaters trennt, trennt sich der Jugendliche mit Hilfe der Peergroup von den Eltern und verinnerlicht die Normen und Werte seiner Generation, das sogenannte Generationen-Über-Ich, das dem elterlichen in vielen Aspekten entgegenwirkt. Neben der Wiederbelebung der Loslöse- und Individuationskrise kommt es durch den Triebschub zur Reaktivierung der ödipalen Konflikte, die mit der Partnerfindung schließlich verarbeitet werden.
1.6 Die narzisstische Entwicklung
Die Entwicklung des Selbst wird auch als narzisstische Entwicklung bezeichnet. Ursprünglich ging Freud davon aus, dass in den ersten Wochen und Monaten eine Objektliebe zur Mutter vorhanden ist, dann im Stadium des Autoerotismus eine Abwendung von ihr erfolgt, die dann wieder in eine Zuwendung mündet. »Als die anfänglichste Sexualbefriedigung noch mit der Nahrungsaufnahme verbunden war, hatte der Sexualtrieb ein Sexualobjekt außerhalb des eigenen Körpers in der Mutterbrust. Er verlor es nur später … Der Geschlechtstrieb wird dann in der Regel autoerotisch und erst nach der Überwindung der Latenzzeit stellt sich das ursprüngliche Verhältnis wieder her … Die Objektfindung ist eigentlich eine Wiederfindung« (Freud 1905d, S. 123). Als Freud 1914 das Konzept des primären Narzissmus formulierte, nahm er an, dass am Anfang ein subjektiver Zustand der Unabhängigkeit von der Umwelt vorhanden sei. Im Gegensatz dazu hat Balint (1937) die erste Auffassung Freuds aufgegriffen und den primären Zustand als den Zustand der primären Liebe dargestellt. Keiner zweifelt heute an einer intensiven Abhängigkeit und Beziehung zwischen Säugling und Mutter. Wichtiger scheint die Frage, wie Affekte oder Triebe die Besetzung des Selbst und des Objektes gestalten.
Narzisstisch werden all diejenigen Fantasien, Tendenzen oder Befriedigungen genannt, die durch eine Bewegung vom Objekt weg zum Selbst hin charakterisiert werden. In dieser »Entweder-oder-« Form ist Narzissmus ein Schutz und Abwehrvorgang. Mit Narzissmus ist aber auch ein System des Selbst gemeint, das alle Befriedigungen, Affekte und Mechanismen, die der Regulation des Selbstwertgefühls dienen, kennzeichnet. Ereignisse, die das Gegenteil bewirken, werden narzisstische Kränkungen genannt. Bei der Triebentwicklung besteht ein Gegensatz von Befriedigung und Frustration, der Narzissmus entwickelt sich innerhalb der Pole einer positiven narzisstischen Spiegelung und der Kränkung. Das Selbst baut sich auf über Spiegelung, dem sogenannten »Glanz im Auge der Mutter«. Die frühesten positiven Selbstrepräsentanzen sind von positiven Objektrepräsentanzen noch ungetrennt. Die narzisstische Zufuhr ist von äußeren Objekten abhängig. Für die Spiegelung des Selbst braucht es Selbstobjekte, die diese Funktion übernehmen. Auch Erwachsene sind in ihrem Selbsterleben noch von positiver Spiegelung abhängig.
Die narzisstische Homöostase ist durch Kränkungen, Misserfolg, Entzug affektiver Zufuhr gefährdet. Das Ich bevorzugt bestimmte Abwehrvorgänge zur Stabilisierung der narzisstischen Homöostase, zum Beispiel die Regression in den primären Zustand oder die Verleugnung der schmerzlichen Realität mit Hilfe von Größenfantasien. Kohut (1973) beschreibt das Größen-Selbst als eine das Selbst stabilisierende Abwehr von Trennungsangst, die im Kindesalter normal ist. Hinzu kommt im Kindesalter die Idealisierung der Elternimagines. Das Selbst sucht auch eine Rettung des Selbstgefühls durch Identifizierung mit omnipotenten und allwissenden Objekten.
Im Gegensatz zu Triebobjekten braucht das Selbst Selbstobjekte, um gespiegelt zu werden und um Objekte zu idealisieren, damit es sich mit ihnen identifizieren kann. Allmählich wird das Bild der Eltern realistischer. Dieser von Kohut beschriebene Prozess von magisch überhöhter hin zu realistischer Selbst- und Objektwahrnehmung wird in ähnlicher Weise von Winnicott (1971) als Prozess der Desillusionierung von der Fantasie zur Realität beschrieben. Das magische Weltbild (Piaget 1980) ist das frühere, weil es die Angst und Hilflosigkeitsgefühle des kleinen Kindes bewältigen hilft.
Das Ichideal tritt später das Erbe des frühen Narzissmus an. Ein gesundes Ideal-Selbst macht Menschen relativ unabhängig von Lob und Tadel. Es ermöglicht innere Sicherheit, Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen.
2 Konflikte, Abwehrmechanismen und Symptombildung
2.1 Konfliktmodell
Zentrale Bedeutung bei der Entstehung psychischer Störungen hat das sogenannte Konfliktmodell. Die Konzepte des Lust- und Realitätsprinzips, des Abhängigkeits- und Autonomiekonfliktes sowie der narzisstischen Spiegelung und Kränkung beinhalten bereits, dass auch die normale psychische Entwicklung auf Konflikten beruht, die eine gewisse Dynamik, die Psychodynamik, erzeugen. Die Psychoanalyse unterscheidet dabei bewusste und unbewusste sowie äußere und innere Konflikte. Ein äußerer Konflikt ist beispielsweise einer zwischen den Wünschen eines Kindes und einem Elternteil, der sich verbietend oder versagend verhält. Ein innerer Konflikt ist der zwischen Es und Über-Ich, wenn der verbietende Part inzwischen zur inneren Struktur geworden ist, ein Student beispielsweise zwischen dem Wunsch, nicht in die Vorlesung zu gehen, und dem Über-Ich-Druck, hinzugehen, in einen inneren Zwiespalt gerät. Das Über-Ich äußert sich dann in Schuldgefühlen. Durch die Über-Ich-Bildung sind ehemals äußere Konflikte zu inneren Konflikten geworden und sind so ein Garant für die bessere Anpassung an die Forderungen und Erwartungen der Umwelt. Konflikte rufen innere Spannungen hervor, die gelöst werden wollen, um zu einer Art Homöostase zu gelangen.
Während der bewusste Konflikt dem Ich zugänglich ist und nach einer bewussten Lösung drängt, sind unbewusste Konflikte verdrängt oder auf andere Weise abgewehrt und können zur Symptombildung führen. Bei psychischen Störungen spielen gerade die unbewussten Konflikte eine zentrale Rolle. Konflikte können mit chronischen oder akuten traumatischen Erfahrungen verbunden werden. Ein Trauma besteht aus einer unerträglichen Erfahrung von Angst, Scham oder anderen unlustvollen Affekten, die zu einem partiellen Zusammenbruch des Ich führen und eine Mobilisierung von Abwehrmechanismen in Gang setzen. Die Abwehrmechanismen geben dem Ich Zeit zur Neuorganisation und zur Bewältigung der Affekte. Sie können aber auch zur Symptombildung führen und damit zu psychischer Erkrankung. Es entsteht eine neue Leidensquelle.
Art und Niveau des Konfliktes sind dabei maßgeblich für die Entwicklung bestimmter Störungen. Die klassische Einteilung der Psychoanalyse geht dabei davon aus, dass neurotische Konflikte aus sogenannten reiferen, weil später in der Entwicklung auftauchenden Konflikten bestehen, den Konflikten zwischen Es und Über-Ich. Die narzisstischen Störungen dagegen beruhen mehr auf einer Störung des Selbst, einem strukturellen Mangel in Form einer Ich-Schwäche oder Schwäche des Selbst. Die narzisstische Homöostase ist labil. Mentzos (1984, S. 83) weist jedoch darauf hin, dass die sogenannte Ich-Schwäche letztlich auch auf ungelösten Konflikten beruht, und zwar auf sehr frühen Konflikten, beispielsweise dem Abhängigkeits-Autonomiekonflikt oder einem Selbstwertkonflikt. Genetisch gesehen sind alle psychischen Störungen konfliktbedingt. Die Ich-Stärke und Selbstkohärenz befinden sich auf unterschiedlichen Niveaus, die der klassischen Einteilung psychischer Störungen entsprechen: Neurotische Störungen, narzisstische Störungen, psychosomatische Störungen, die ebenfalls den narzisstischen Störungen zugerechnet werden, aber in ihrer Symptombildung den Körper einbeziehen, den Borderline-Störungen und Psychosen, die als früheste Störungen gelten, weil Selbst und Ich am schwerwiegendsten und umfassendsten beeinträchtigt sind, die Anpassung an die Umwelt bei den Psychosen am wenigsten möglich ist.
Читать дальше